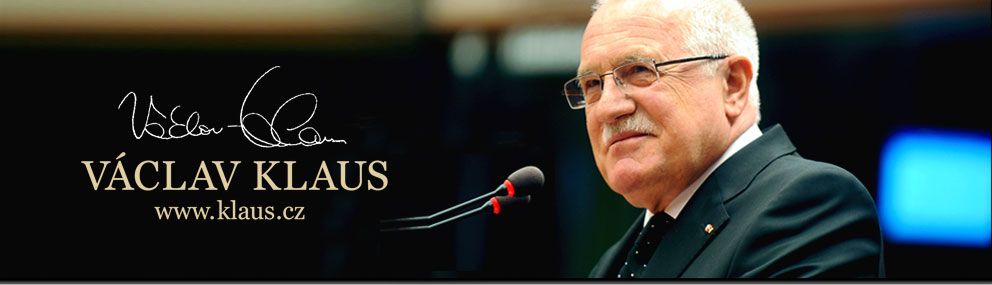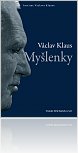Nejnovější
Nejčtenější
Hlavní strana » Deutsche Seiten » Interview des Präsidenten der…
Interview des Präsidenten der Tschechischen Republik für die Südtiroler Wirtschaftszeitung
Deutsche Seiten, 25. 2. 2011
SWZ: Herr Staatspräsident, Ihr Thema beim Südtiroler Wirtschaftsforum trägt den pointierten Titel „Europa hat eine Zukunft – aber eine nicht allzu rosige“. Welche Farbe hat denn Europas Zukunft?
VK: Die Farbe ist nicht so wichtig, aber Europa sollte sich nicht in die eigene Tasche lügen: Seine Lage ist nicht allzu rosig. Neulich hat mich jemand in einer Diskussion gefragt, warum ich Europas Situation so negativ beurteile. Er war der Meinung, dass Europa für die meisten Länder der Welt als Vorbild steht. Für mich war die Aussage ein gutes Beispiel dafür, wie man sich derzeit in Europa selbst belügt – leider ist diese schlechte Angewohnheit in Europa sehr verbreitet. Ich halte mich sehr oft in verschiedenen Ländern anderer Kontinente auf, aber die These, wonach Europa ein Vorbild wäre, habe ich dort niemals gehört.
Dass Sie ein Europa-Skeptiker sind, ist hinlänglich bekannt. Was ist es in erster Linie, was Sie an Europa stört?
Ich bin kein Europa-Skeptiker. Ich beobachte nur mit kritischem Blick die Entwicklungen in Europa und frage nach dem Warum für diese Entwicklungen. Meine Antwort ist, dass dazu auf der einen Seite die zu paternalistische Doktrin der sozialen Marktwirtschaft und auf der anderen Seite die kontraproduktive Zentralisierung, Harmonisierung, Standardisierung und Unifizierung Europas unter der Fahne der europäischen Integration beigetragen haben. Das hat mit Skepsis als persönlicher Lebenseinstellung nichts zu tun. Ich bemühe mich lediglich um eine analytische Erklärung.
Ist die Europäische Union eine Fehlkonstruktion, die gut gemeint war, aber schlecht umgesetzt wurde?
Die Bezeichnung „Fehlkonstruktion“ ist nicht schlecht. Ich betrachte die Europäische Union als Institution mit einem Geburtsfehler sowie mit einem problematischen Werdegang. Sie war von ihren Initiatoren nicht gut gemeint, oder vielleicht war sie gut gemeint für sie selbst. Sie wollten und wollen Europa, das heißt uns, dirigieren. Für diejenigen, die nicht in Brüssel herrschen oder von Brüssel leben, war das bestimmt nicht gut gemeint. Überhaupt reagiere ich sehr empfindlich auf die Hypothese, dass etwas gut gemeint, aber schlecht umgesetzt wird. Das haben wir in der kommunistischen Ära jeden Tag gehört.
Tatsache ist aber, dass in Europa Frieden herrscht und der Wohlstand eigentlich in allen Ländern im Steigen begriffen ist. Ist das kein Verdienst der Europäischen Union?
Der Frieden ist ohne Zweifel kein Verdienst der Europäischen Union. Die EU ist eine Folge des Friedens. Die Tragödie des Zweiten Weltkrieges war so groß und so grauenhaft, dass sie – mindestens für unser Zeitalter – ihre eigene Wiederholung verhindert. Wir haben auch die NATO, die in diesem Sinne viel wichtiger als die Europäische Union ist. Mit dem Wohlstand ist es in der EU auch nicht so gut bestellt. Mit der Ausnahme von Ländern, die Krieg führen bzw. die Revolutionen durchmachen oder durchgemacht haben, ist das Wirtschaftswachstum in der EU in den letzten Jahrzehnten das schwächste der Welt. In Ihrem Land, in Italien, zum Beispiel war das reale Wirtschaftswachstum in der letzten Dekade gleich null oder sogar negativ. Ist das ein Erfolg?
Gehen Sie etwa davon aus, dass die Europäische Union wieder zerbrechen wird? War die Griechenlandkrise nur ein erstes wirtschaftliches Symptom für einen unausweichlichen Zerfall?
Obwohl für mich die Europäische Union eine sehr problematische Konstruktion ist, bin ich nicht der Meinung, dass sie zerbrechen wird. Sie wird weiter existieren, aber die Kosten dieser Existenz werden weiter und weiter steigen. Die Hypothese, dass ihr Funktionieren keine Kosten verursacht bzw. dass die Kosten viel niedriger als ihre Vorteile sind, ist unhaltbar. Das wissen die Leute in Europa, besonders nach der Griechenlandkrise, sehr gut. Für mich ist es aber unverständlich, dass sie es nicht schon früher bemerkt haben.
Wirtschaftlich wäre ein Zerfall doch eine Katastrophe, oder? Allein die gemeinsame Währung, der Euro, hat doch viele positive Seiten.
Ich bin nicht der Meinung, dass die gemeinsame Währung in einer nicht-optimalen Währungszone mehr positive als negative Seiten hat. Und die heutige Eurozone von 17 sehr heterogenen Ländern ist ganz sicher keine optimale Währungszone. Dass wir alle zu viel für die Existenz des gemeinsamen Währungssystems in Europa zahlen, sollten wir wissen. Ich erwarte keinen Zerfall der Eurozone, aber als Volkswirt muss ich sagen, dass es keine Katastrophe darstellen würde, wenn die Zahl der Euroländer gesenkt würde. Ich habe „den Zerfall“ der tschechoslowakischen Währungszone miterlebt und ohne Freude mitorganisiert – und er hat keine Katastrophe hervorgerufen.
Sie waren als Spitzenpolitiker der ehemaligen Tschechoslowakei eine der treibenden Kräfte einer Spaltung in die zwei Staaten Tschechien und Slowakei. Wenn Sie heute zurückblicken: War es wirklich der einzig richtige Weg?
Ich wurde in der Tschechoslowakei geboren oder besser gesagt im Reichsprotektorat Böhmen und Mähren, das es damals leider war. Ich dachte immer, dass ich dort auch sterben würde. Deshalb wollte ich meine Heimat, die Tschechoslowakei, aufrechterhalten. Zu meiner Enttäuschung wollten das aber die Slowaken nicht. Trotzdem muss man heute sagen, dass die Spaltung der ehemaligen Föderation den beiden Ländern in verschiedenen Aspekten geholfen hat. Das akzeptieren heute fast alle in diesen beiden Ländern, im Ausland versteht man das nicht so gut. Das ist aber ganz logisch. Als Außenstehender hatte ich auch nichts gegen das alte Jugoslawien.
Was macht Sie so sicher, dass sich die Tschechoslowakei nicht exakt gleich entwickelt hätte wie es Tschechien und die Slowakei als alleinstehende Staaten getan haben?
Es fehlte dem damaligen Staat an Homogenität, wobei seine Homogenität immer noch größer war als jene der heutigen EU oder der beiden Deutschland zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung. Besonders die Slowaken haben die Konsequenzen dieser mangelnden Homogenität gespürt. Darüber hinaus wollten sie zum ersten Mal in der Geschichte ihren eigenen Staat haben. Das musste ich akzeptieren.
Im 500.000-Einwohner-Land Südtirol sind die Abnabelungsgelüste vom Staate Italien ebenfalls groß. Die Mehrheitspartei SVP bemüht sich um den ständigen Ausbau der Autonomie, die bereits jetzt sehr weit reicht, Oppositionsgruppen streben sogar einen eigenen Staat an. Was wäre Ihre Politik, wenn Sie Präsident von Südtirol wären.
Ich habe keine Ambition und auch kein Recht, irgendwelche Empfehlungen auszusprechen. Wir haben die Spaltung der Tschechoslowakei so schnell – und friedlich und freundlich – abgewickelt, dass der Rest der Welt keine Gelegenheit hatte, sich in unsere inneren Angelegenheiten einzumischen. Und das war der Sieg. Die Entwicklungen in Jugoslawien zeigen, wie kontraproduktiv die externe Einmischung war. Das war für mich eine klare Warnung. Südtirol ist in einer anderen Lage. Während meiner Skiaufenthalte in Südtirol – mein Lieblingsort ist der Kreuzbergpass – habe ich gelernt, dass die Südtiroler mehr pro-Brüssel als pro-Rom sind. Deshalb stehen sie dem Trend zur Schwächung und Untergrabung der Nationalstaaten in Europa und zur Schaffung des „Europas der Regionen“ unkritisch gegenüber.
Mal ehrlich, was veranlasst Sie, sozusagen in der „Provinz“ ein Referat zu halten? Brixen ist nicht Berlin, und das Südtiroler Wirtschaftsforum ist nicht das World Economic Forum von Davos.
Ich schätze die Einladung nach Brixen. In Brixen war ich noch nie, obwohl es sich für uns Tschechen um einen bekannten Ort handelt: Nach Brixen wurde zur Zeit der Österreichisch-Ungarischen Monarchie der berühmte tschechische Schriftsteller und Journalist Karel Havlíček Borovský ins Exil geschickt. In Davos war ich schon fast zwanzig Mal und trotzdem fühle ich mich dort nicht wohl. Die Leute, die die „Global Governance“ darstellen und ausüben wollen, sind nicht „meine“ Leute. Der Homo Davosensis ist eine gefährliche Menschenart, der Homo Brixensis ist bestimmt viel freundlicher.
Christian Pfeifer, Südtiroler Wirtschaftszeitung, 25. Februar 2011
- hlavní stránka
- životopis
- tisková sdělení
- fotogalerie
- Články a eseje
- Ekonomické texty
- Projevy a vystoupení
- Rozhovory
- Dokumenty
- Co Klaus neřekl
- Excerpta z četby
- Jinýma očima
- Komentáře IVK
- zajímavé odkazy
- English Pages
- Deutsche Seiten
- Pagine Italiane
- Pages Françaises
- Русский Сайт
- Polskie Strony
- kalendář
- knihy
- RSS
Copyright © 2010, Václav Klaus. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných na tomto serveru.