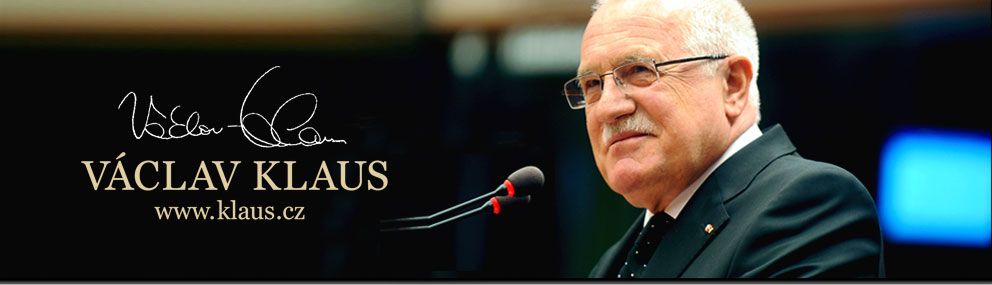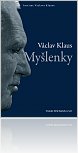Nejnovější
- Václav Klaus pro MF Dnes: Jde někomu ještě o tuto zemi?
- Václav Klaus pro iDNES: SMS považuji za nešťastné, ale žádné vydírání to není
- Ivo Strejček: Pražský hrad jako centrum opoziční politické moci
- Ladislav Jakl: Kapitalismu je 35. Všechno nejlepší a dlouhá léta
- Václav Klaus pro Protiproud: O střetu Hradu s vládou 35 let po spuštění kapitalismu
Nejčtenější
- Václav Klaus pro iDNES: SMS považuji za nešťastné, ale žádné vydírání to není
- Václav Klaus pro Protiproud: O střetu Hradu s vládou 35 let po spuštění kapitalismu
- Ivo Strejček: Kvadratura grónského kruhu a český zájem
- Ivo Strejček: Pražský hrad jako centrum opoziční politické moci
- Jiří Weigl: Německé výročí v závoji nejistot
Hlavní strana » Deutsche Seiten » Karl-Schiller-Vorlesung:…
Karl-Schiller-Vorlesung: Europa 10 Jahre nach dem Zusammenbruch des Kommunismus - von Prag aus gesehen
Deutsche Seiten, 31. 8. 2000
Als ich darüber nachgedacht habe, welchem Thema ich meine Schiller-Vorlesung hier in Freiburg widmen sollte - an dieser Stelle möchte ich meine große Hochachtung für die Einladung zu dieser Vorlesung ausdrücken - habe ich verstanden, daß für mich gar kein anderes Thema als das Problem der Zerbrechlichkeit und Verletzbarkeit der Freiheit und der Demokratie einerseits und der Marktwirtschaft andererseits im heutigen Europa, und dies in seinen beiden Teilen, eigentlich in Frage kommt. Wahrscheinlich werde ich auch in der Zukunft kein anderes wichtigeres Thema haben.
Im Juli 1995, bei meinem ersten Auftritt in Ihrem Institut, sprach ich über Walter Eucken, über seinen Beitrag zu der Volkswirtschaftstheorie und zu dem Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft (und Gesellschaft) nach dem Jahre 1945. Ich bemühte mich auch, die, in der postkommunistischen Welt verlaufenden Transformationsprozesse mit den Augen von Eucken zu bewerten. Heute, nach fünf Jahren, sind wir in Mittel- und Osteuropa - bei aller Kompliziertheit der Entwicklung - sicherlich weiter. Eine bestimmte und keineswegs einfache Entwicklung war in dieser Zeit auch in Westeuropa.
Gerade zu diesen Fragen möchte ich heute einige Worte an Sie richten und dabei auch an Karl Schiller, den wir hier gemeinsam gedenken, anknüpfen. Ich habe ihn persönlich kaum gekannt. Seine wichtigste Ära war in den Zeiten, in denen wir - in der damaligen Tschechoslowakei - nicht in den Westen reisen durften. Ich hatte nur einmal Gelegenheit mit ihm kurz zu sprechen. Es war im Jahre 1993 in Bonn, nach meinem Vortrag anläßlich der Ludwig-Erhard-Preisverleihung. Seinen Namen kannte ich jedoch schon damals ganz gut. Ich wußte, daß er ein bedeutender deutscher Ökonom und Politiker war, der sowohl an die Freiburger Schule des Walter Euckens als auch an die keynesianische Makroökonomie anknüpfte. Ich wubte auch, dab er die wirtschaftspolitischen Konzepte der deutschen Sozialdemokratie (insbesondere ihr Godesberger Programm) in wichtiger Weise beeinflußte. Obwohl ich kein Anhänger seiner Formel bin: “Wettbewerb so viel wie möglich, Planung so viel wie nötig”, muß ich die intellektuelle Aufrichtigkeit wertschätzen, mit der er seine wirtschaftspolitischen Konzepte durchsetzte und nicht zuletzt auch das, daß er auch den Argumenten aus dem liberalen und konservativen Lager zugänglich gewesen war.
Ich weiß auch, daß er einer der 60 Ökonomen war, die im Jahre 1992 vor einer überstürzten Einführung der gemeinsamen europäischen Währung warnten. Ich selbst stand schon damals dieser Einstellung sehr nahe und teile sie auch heute. Ich muß auch sein letztes Buch erinnern, das im Dezember 1993 herausgegeben wurde, in dem er - mit dem Titel “Der schwierige Weg in die offene Gesellschafft” - die Schwierigkeiten des Transformationsprozesses im östlichen Teil Deutschlands analysierte. In einem Lande, das sich von anderen postkommunistischen Ländern dadurch unterschied, dab es vom Außen, von dem zweiten Teil Deutschlands, eine außerordentlich großzügige Hilfe erhalten hat. Dieses Buch ist eine wertvolle Inspiration auch für uns, die die Kosten der Transformation allein, auf den eigenen Schultern, tragen mubten.
Über die Transformation und die damit verbundenen Kosten könnte man sehr lange diskutieren. Ich möchte mich jedoch heute mit anderen Fragen beschäftigen. Gleichzeitig mit der Transformation in den postkommunistischen Ländern, die nach dem Ablauf eines Jahrzehnts schon in ihre Abschlußphase gelangt, verlaufen weitere wichtige wirtschaftliche, politische und kultur-zivilisatorische Prozesse. Ich möchte für heute nur drei hervorheben. Es ist die Einigung Deutschlands, das Teilen der Tschechoslowakei und die Unifizierung Europas.
In diesen drei Fällen handelt es sich um eine Verflechtung von politischen und ökonomischen Erscheinungen (die sich in der Makro-Welt abspielen) mit den Schicksalen von Menschen, ihren Hoffnungen und Träumen (die ausschließlich der Mikro-Welt angehören). Das Problem besteht insbesondere darin, daß sich diese Erscheinungen mehr oder weniger autonom entwickeln und jede von ihnen eine eigene und deshalb unterschiedliche Dynamik hat, was die Kosten der durchgeführten Veränderungen erhöht.
Vom analytischen und strikt ökonomischen Standpunkt handelt es sich in allen diesen Fällen um das Problem der Einführung oder des Zerfalls einer Währungsunion, bzw. darum, ob eine formal existierende Währungsunion eine optimale Währungszone ist oder nicht ist.
Im Fall von Deutschland handelte es sich im Jahre 1990 eindeutig um keine vorbereitete, optimale Währungszone. Die damalige abrupte Abschaffung des Währungskurses (der damals die Schlüsselvariable dargestellt hatte, die eine gewisse Kompatibilität der sehr unterschiedlichen Parameter beider Wirtschaften sicherte) bedeutete de facto die Beendigung des vormaligen Funktionierens der ostdeutschen Wirtschaft. Diese mußte entweder aufhören zu funktionieren und eine lange und tiefe, schumpeterische “schöpferische Destruktion” eintreten, deren Länge und Tiefe vorher unbekannt war (mit massiver Abwanderung der Einwohner vom Osten in den Westen). Oder mußten umfangreiche, in dieser Größenordnung in der Geschichte bisher unbekannte und wahrscheinlich auch unwiederholbare, finanzielle Transfers organisiert werden, die in Form einer Redistribution die objektiv bestehenden Unterschiede der ökonomischen Parameter beider Wirtschaften allmählich ausgleichen sollten. Wir alle wissen, daß die zweite Alternative eingetreten ist. Ich möchte daran erinnern, daß noch heute, 10 Jahre nach der Einführung der deutschen Währungsunion, die jährlichen finanziellen Transfers in die neuen Bundesländer das jährliche Bruttosozialprodukt der Tschechischen Republik übersteigen.
Ich habe überhaupt keine Ambitionen, die möglichen Alternativen der damaligen Lösung zu diskutieren. Jedoch bin ich davon überzeugt, daß wir alle die Verpflichtung haben, die damals gewonnenen Erkenntnisse zu nutzen und eine verallgemeinerte und vor allem eine nachhaltige Lehre daraus zu ziehen. Für mich ergibt sich daraus vor allem die Schlußfolgerung, daß die Abschaffung einer wichtigen ökonomischen Variablen (und ihre Umwandlung in eine Konstante) riesige ökonomische Kosten verursacht.
Leider handelt es sich dabei nicht nur um ökonomische Kosten. Über die “psychologischen” Kosten erlaube ich mich hier fast nicht zu sprechen. Ich bin aber überzeugt, daß sie nicht kleiner waren. Nicht nur die Wirtschaft als Ganzes, sondern auch jeder einzelne Mensch wurde durch den Währungskurs “geschützt” und seine persönlichen “Leistungsparameter” waren - wenn der Kurs auf dem richtigen Niveau stand - gerechtfertigt. Die kalte Dusche nach seiner Abschaffung hat für Millionen von Menschen - als Gegensatz zu ihrer Freude über die neu gewonnene Freiheit und über das Ende des Kommunismus - ein nicht geringes menschliches Trauma verursacht. Ich sage es als Außenstehender, als jemand, der in dieser Richtung keine quantifizierbare empirische Untersuchung durchgeführt hat.
Die in der damaligen Tschechoslowakei verlaufenen Prozesse schienen zwar auf den ersten Blick andere zu sein, jedoch war ihr struktureller Kontext gleich. Er hatte nur ein gegensätzliches Vorzeichen. Wir waren Zeugen des Zerfalls einer Währungsunion. Der Grund dafür waren die ungleichen Parameter der Wirtschaft in beiden Landesteilen, die verschiedene Interpretation der Ursachen dieser Unterschiede und eine, nicht gleiche Meinung sowohl über die Größe als auch über die Notwendigkeit der existierenden finanziellen Transfers. Nach sieben Jahrzehnten einer Nichtexistenz des gegenseitigen Währungskurses (wenn ich von der Beziehungen zwischen dem Protektorat Böhmen und Mähren und dem Slowakischen Staat in der Kriegsepisode absehe), sind im Februar 1993 zwei eigenständige Währungen entstanden, deren Kurs sich nach einer gewissen Zeit auf dem Verhältnis 1,1 : 1 eingepegelt hat. Trotz aller nachfolgenden Turbulenzen verbleibt es bei diesem Verhältnis, womit anzudeuten ist, daß es für beide Wirtschaften geeignet ist.
Im Vergleich zu Deutschland ist die Differenz im Kurswert beider Währungen in Höhe von 10 % relativ klein, aber - wenn die ökonomischen Theorien und die Standardvoraussetzungen über die Preiselastizität einen Sinn haben - ist auch solche Differenz wichtig. Wichtig ist auch die Möglichkeit, diesen Unterschied in der Zukunft in einer beliebigen Richtung zu verändern. Die nachträglichen Ersparungen der Transaktionskosten dank der Einführung der Währungsunion, bzw. die erhöhten Transaktionskosten bei ihrem Zerfall - wenn weiterhin die Freihandelszone und die Zollunion bestehen bleibt - scheinen fast nicht erwähnenswert zu sein. Aber auch bei uns ging es nicht nur um ökonomische Aspekte. Die Abschaffung der politischen Union (und der Währungsunion) in der damaligen Tschechoslowakei bedeutete eine große politische Beruhigung und hatte auch einen wichtigen psychologischen, und zwar eindeutig positiven Effekt. Diese Ereignisse mit Begriffen wie Nationalismus oder Abwesenheit von irgendwelchen “höheren Zivilisationswerten” zu diskutieren - wie es heute üblich ist - ist ein absoluter Irrtum.
Ohne billige politische Rhetorik und ohne aprioristische Einstellungen sollten auch die heutigen Unifizierungstendenzen in Europa beurteilt und ihre wahrscheinliche Auswirkungen seriös analysiert werden. In diesen Fragen sind wir jedoch Zeugen unglaublicher Vereinfachungen und eines Karikierens jener Ansichten, die vom Mainstream-Denken abweichen.
Wir leben in einer besonderen Zeit der europäischen Geschichte. Wir leben in einer Zeit, in der Nationalstaaten bzw. ihre Souveränität in Frage gestellt werden. Oder anders gesagt, wir leben in einer Zeit, wo die äußeren Standpunkte der eigenen souveränen Entscheidungen der einzelnen Länder über ihre internen Angelegenheiten übergeordnet werden. Die Art und Weise mit der die Europäische Union mit Österreich in diesem Jahr umgegangen ist, die Art und Weise mit der die internationale Gemeinschaft mit Jugoslawien im vergangenen Jahr umgegangen ist, aber auch der Umgang der Europäischen Union mit den Beitrittskandidaten aus Mittel- und Osteuropa, über den Umgang mit England in der Zeit der "Mad Cows" ganz zu schweigen, sind - meiner Meinung nach - sehr ähnlich. In allen diesen Fällen handelt es sich nur auf den ersten Blick um isolierte und in keiner Weise im Zusammenhang stehende Erscheinungen. Ich bin überzeugt, dab sie alle - bei aller Unterschiedlichkeit - etwas wichtiges gemeinsam haben.
Diese gemeinsame Sache ist der Versuch das Äussere in das Innere der europäischen Länder hineinzutragen. Ganz absichtlich mache ich kein vereinfachtes Werturteil und sage nicht, ob es sich um richtige oder um falsche Ideen und Positionen handelt, denn darum geht es hier wirklich nicht. Es geht darum, dab es sich um Ansichten von konkreten Personen handelt, also um Ansichten, die partiell, zeitlich bedingt und interessengebunden sind. Der Anspruch auf ihre apriorisch beanspruchte Universalität, zeitliche Unabhängigkeit und tabuisierende Undiskutierbarkeit, muss klar und deutlich abgelehnt werden.
Gerade deshalb steht Europa heute an einer sehr gefährlichen und unübersichtlichen Kreuzung. Es ist dort angelangt aufgrund der Kumulation einer ganzen Reihe von Prozessen, die sicherlich nicht neu sind. Sie existieren schon längere Zeit unter der Oberfläche, neu ist nur ihr synergistischer Effekt.
Zu ihnen gehören:
1. Der Kollaps des Kommunismus (ich verwende absichtlich das Wort Kollaps und nicht das Wort Niederlage), der zum allgemeinen Verlust der Aufmerksamkeit und Wachsamkeit geführt hat. Das hat dazu beigetragen, daß das hoffnungsvolle Ende eines linken Abenteuers nicht zur liberalen Ordnung, sondern zu einem leichten Sieg des Sozialdemokratismus und verschiedener dritter Wege geführt hat (die in ihrem Wesen nichts anderes als zweite Wege sind);
2. Der neu geborene und mit einer neuen Vehemenz verbreitete Glaube an die Fähigkeit der internationalen intellektuellen Elite (und an die, an sie angeknüpften staatlichen Bürokratie), “eine Besitzerin der Wahrheit, der Vernunft und des Fortschritts” zu sein, ergänzt durch ihr Selbstbewußtsein -mit der vermeintlichen Berechtigung - die eigenen Standpunkte auch außerhalb der politischen Standardmechanismen durchsetzen zu können;
3. Beispiellose Liberalisierung und Öffnung gegenüber der Welt, die das - in manchem positive, nichtsdestoweniger sehr dramatische und nicht für jedermann barmherzige - Eindringen des Fremden, Anderen, Neuen in einen Raum ermöglichten, die ich mangels eines besseren Terminus mit einem Begriff aus der Psychologie als “intimen Raum” bezeichnen möchte, auch wenn es sich in diesem Fall nicht um den intimen Raum eines Individuums handelt, sondern der Familie, der Komunität, des Volkes;
4. Verschiedene kosmopolitische, Integrations- und Globalisierungstendenzen, die die ewige, aber immer wieder neue und wiederholte menschliche Suche nach der eigenen Identität dramatisieren und die die Befürchtungen aller Schwächeren oder der “nur” etwas Kleineren verstärken;
5. Beschleunigte Unifizierungstendenzen, die in Europa ohne entsprechende Unterstützung in der Welt von Ideen verlaufen und vor allem ohne die so sehr notwendige Führung großer europäischer Politiker, die in der Lage wären, sie den Bürgern Europas zu erklären und klar und deutlich die Notwendigkeit der Schwächung des Nationalstaates zu Gunsten des heute so sehr fetischisierten Gesamteuropäertums zu verteidigen;
6. Die Befreiung der von Kommunismus unterdrückten Menschen und als Folge dieser neuen Freiheit das "Zerbröckeln" von Staaten und bedeutende Veränderungen der Staatsgrenzen (die in Europa nach dem I. oder dem II. Weltkrieg enstanden sind);
7. Radikale Erhöhung der Mobilität der Arbeitskräfte zwischen den einzelnen europäischen und auch nichteuropäischen Ländern und dadurch auch Anstieg von Unsicherheit bei den Bürgern, Ihre Unruhe und Ihr Gefühl von Bedrohung. Diese Gefühle existieren, ob wir dies wollen oder nicht, ob wir darüber sprechen oder nicht, ob unsere Rhetorik mancher als “politically correct” oder auch “politically incorrect” bezeichnet. Diese Mobilität wird durch die allgemeine Liberalisierung ermöglicht, aber ihr Ursprung ist in der Diskrepanz der Struktur der Arbeitsnachfrage und des Arbeitsangebots, die dadurch charakterisiert ist, daß die Arbeitsnachfrage in den “reichen” Ländern Europas nicht dem in diesen Ländern generierten Arbeitsangebot entspricht.
Mit einer gewissen Übertreibung könnte man sagen, daß infolge dieser Prozesse die Jahrtausendwende eine Zeit der parallelen Integration sowie der Desintegration ist, eine Zeit der nominalen Integration sowie der realen Desintegration, eine Zeit der Integration in den Makrodimensionen und der Desintegration in der Mikro-Welt ist.
Der heutige europäische Integrationsprozeß ist ein wichtiger Bestandteil dieser Prozesse. Er ist ihre Folge, gleichzeitig jedoch auch ihre Ursache. Es handelt sich aber um einen intern widersprüchlichen Prozeß. Ich sehe Ansichten und Interessen der heutigen “Eurokratie”, die sehr stark von Ansichten und Interessen der normalen Einwohner Europas divergieren. Ich sehe ein sehr ernsthaftes Interesse der Kandidatsländer, sich am europäischen Integrationsprozeß authentisch zu beteiligen und sehe auch ihre große Sorge über ihre eventuelle Aussperrung. Ich sehe aber auch rationale Gründe der heutigen Mitgliedsstaaten, den status quo zu konservieren. Das ermöglicht ihnen die für sie günstigen Folgen ihrer komparativen Vorteile zu maximieren, die sowohl aus ihrer Wirtschaftskraft als auch aus ihrer Verwaltungsübermacht resultieren. Ich sehe auch die institutionale Nichtvorbereitung oder nichtgenügende Vorbereitung der EU auf ihre Erweiterung.
Das ist aber nur eine Seite der Sache. Es scheint mir absolut evident, daß Europa für lange Zeit sich nicht mit seinem Unifizierungsprojekt zufriedenstellen darf. Denn dieses stellt nur ein “Ergänzungsprogramm” und im schlimmeren Fall sogar nur ein “Ersatzprogramm” dar. Das Hauptprogramm für die Zukunft Europas muß seine Transformation zu den Institutionen der klassischen, europäischen liberalen Ordnung sein. Nur ein solches Europa anzustreben ist für das 21. Jahrhundert sinnvoll. Und ich glaube, dab gerade das zu den Haupthemen von Walter Eucken Institut gehört.
Das bedeutendste gegenwärtige europäische Projekt ist die Währungsunion und das wichtigste Problem sind ihre Folgen, die sicherlich nicht nur kurzfristig sein werden. Wenn ich es mit den Augen der ökonomischen Analyse betrachte, muß ich feststellen, daß das heutige Europa keine “optimale Währungszone” ist, und nicht einmal seine gegenwärtige Zusammensetzung, die E-11 genannt wird (geschweige die E-12, einschließlich Griechenland). Das bedeutet nicht, und es resultiert nicht daraus, daß nationale Währungen nicht abgeschafft werden können und eine gemeinsame Währung nicht eingeführt werden kann, wie es tatsächlich auch geschehen ist. Technisch und verwaltungsmäßig ist das relativ einfach. Es steht jedoch die Frage, um welchen Preis, bzw. mit welchen langfristigen Kosten und Folgen es sich realisieren läßt.
Die nicht homogene Währungszone würde entweder ihre verschiedenen Teile dem eigenen Schicksal überlassen (so wie es z.B. in Italien nach 1860 geschehen ist, oder in Schottland und Wales am Vorabend der Neuzeit), oder sie würde umfangreiche, die menschliche Motivation unterdrückende fiskalische Transfers erfordern (Ostdeutschland in kleinerem Maßstab). Es scheint mir, daß Europa gerade diese Tatsachen nicht in Betracht ziehen will. Vor kurzem habe ich eine interessante amerikanische Studie in die Hand bekommen, die im National Bureau of Economic Research erarbeitet wurde, mit dem Titel “How Long Did it Take the U.S. to Become an Optimal Currency Area” (H. Rockoff, Historical paper 124, NBER, Cambridge, Ma., April 2000). Ihr Autor sagt, daß die USA dafür ganze 150 Jahre benötigten, von den achtziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts bis zu den Dreißigern des zwanzigsten Jahrhunderts. Seine Studie schließt er mit der Empfehlung, andere Währungsunionen sollten diese Erfahrung in Betracht ziehen, und drückt seine Hoffnung aus, daß “die Europäische Währungsunion nicht so lange brauchen wird” (Seite 37).
Ich weiß nicht, was Walter Eucken und die Freiburger Schule dazu sagen würden, und vor allem weiß ich nicht, was sie dazu heute sagen würden. In der Zeit nach der Beendigung der Grauen des II. Weltkrieges hätten auch sie sicherlich die Priorität darin gesehen, einen jeden Krieg in Zukunft zu verhindern und wahrscheinlich würden auch sie - so wie die Mehrheit der damaligen Europäer - daran glauben, daß die europäische Einigung dazu beitragen könnte. Ich bin mir jedoch nicht sicher, daß sie das gleiche auch heute sagen würden. Die heutige Etappe der Vertiefung der europäischen Integration hat doch mit dem Verhindern von jedweden zukünftigen Kriegen keinen unmittelbaren Zusammenhang. Das heutige Ziel der leitenden Gruppe europäischer Politiker (und Intellektuellen) ist Europas Stärkung gegenüber dem “Rest der Welt”, unter der Parole “big ist beautiful”. Darin ist der naive Glaube enthalten, daß “big” besser, stärker, effektiver, wettbewerbsfähiger und womöglich auch demokratischer ist.
Ich glaube nicht, daß Walter Eucken und seine Kollegen mit dieser Auffassung übereinstimmen könnten. Ich denke, daß sie eher ihren Ordoliberalismus betonen würden, und zwar sowohl das “Ordo” als auch den “Liberalismus”, und ich würde eher die Meinung erwarten, im heutigen Europa gebe es zu wenig Liberalismus. Gerade wir, in den postkommunistischen Ländern, spüren es ganz verschärft. Und wir sind darüber überhaupt nicht froh. Dieses Gefühl hat jedoch mit einem Eurooptimismus oder einem Europessimismus nichts zu tun, so wie diese Begriffe geläufig verwendet werden.
Wir beschäftigen uns damit mit dieser Schärfe und erhöhter Aufmerksamkeit vor allem deshalb, da wir uns in einem relativ labilen und leicht verletzbaren Moment unserer Entwicklung befinden.
Anfang der neunziger Jahre haben wir bei uns sehr schnell eine offene, pluralistische, demokratische Gesellschaft gebildet. Ihre Entstehung war überraschenderweise relativ einfach. Es genügte, bestimmte Verbote aufzuheben (dies habe ich einst als passive Transformationsmaßnahmen bezeichnet) und sie allmählich mit dem Aufbau neuer Institutionen (aktive Transformationsmaßnahmen) zu ergänzen.
Demokratisch war auch der gesamte Transformationsprozeß. Niemand hat etwas von oben dirigiert. Es gab keine autokratische Politiker, die die Kraft und das Mandat gehabt hätten, die Transformation nach irgendwelchen eigenen Ambitionen zu “dosieren”. Es handelte sich um einen Evolutionsprozeß, um eine Mischung von Absichten und einer Spontaneität, um beabsichtigte und gewollte Dinge, aber auch um unbeabsichtigte und nicht gewollte Dinge. Die Kritik, und zwar sowohl von innen wie auch von außen, versteht diesen Aspekt meistens nicht. Es wird nicht begriffen, daß es berechtigt ist, ein Projekt (und seine Anwendung) in einer Situation zu kritisieren, in der es “einen Projektleiter” und seine “Untergeordneten” gibt; dies aber trifft für die Transformation der menschlichen Gesellschaft nicht zu. Da handelt es sich um eine evolutionäre, von keinem unmittelbar dirigierte und daher nicht kontrollierbare Entwicklung.
Die Politiker waren Bestandteil dieses Prozesses und hatten darin eine wichtige Rolle. Sie mußten eine Vision der Zukunft bringen, sie mubten Strategie formulieren, wie diese Vision umzusetzen ist, und sie mußten dafür die Öffentlichkeit gewinnen. Sie mußten auch gegen romantische Träume ihrer Mitbürger kämpfen, daß es möglich wäre, anstatt des Kommunismus eine andere Utopie zu schaffen, und auch gegen Träume, daß die Transformation einer ganzen Gesellschaft zum Nullkosten zu haben ist. Sie mußten auch die Folgen eines sehr unangenehmen E-R-Gap bewältigen, das aus der Ungleichmäßigkeit zwischen steigenden Erwartungen (E) und der Realität (R) resultierte. Sie mußten auch das Duell der Demokratie gegen die wachsende Rolle verschiedener Lobbygruppierungen gewinnen. Das alles zusammen hat die Transformationsanstrengungen geschwächt.
Die Politiker konnten aber nicht durch Gesetzgebung, mit Verboten und Geboten oder mit Regulierung ein perfektes System schaffen. Sie konnten die Vergangenheit nicht abschreiben, sie konnten sich nicht an einen Nullpunkt (ohne die vorhandenen Altlasten) stellen und sozusagen von Neuem beginnen. Anstatt eines Rückwärtsfalls an den Punkt Null mußten sie den Umfang der ökonomischen Verluste (gemessen am Output, am Sozialprodukt, an der Beschäftigungsrate) minimieren. Sie durften nicht die Entstehung einer schnellen Inflation oder sogar Hyperinflation zulassen. Sie durften das Land nicht übermäßig verschulden. Sie mußten die elementare soziale Kohärenz des Landes halten (nach dem dramatischen Anstieg der Einkommens- und Eigentumsungleichheit). Sie durften das Land nicht ans Ausland verkaufen und mußten sicherstellen, daß die Transformation eine hohe Inlandsbeteiligung hat.
Sie mußten die Märkte deregulieren, obwohl diese sehr imperfekt waren. Sie mußten auch beim Nichtexistenz des einheimischen Kapitals privatisieren. Sie mubten sich der Welt öffnen, obwohl klar war, daß dies mittelfristig und langfristig einen einseitigen Vorteil für die Außenwelt (und die einheimischen Verbraucher), nicht aber für die einheimischen Produzenten bedeutet. Sie mußten sich den europäischen Integrationsprozessen anschließen, obwohl die Wirtschaftskraft und die Kunst des sophistizierten Protektionismus zum Vorteil der EU standen. Sie mußten Optimisten sein hinsichtlich der Anpassungsfähigkeit ihrer Mitbürger an veränderte Bedingungen, obwohl sie wußten, daß die Inertie menschlichen Verhaltens sehr hoch ist.
Vor allem war es nötig so bald wie möglich anzufangen. Es war nicht möglich zu sagen, daß wir 5, 10 oder 15 Jahre die gesetzlichen Bedingungen und den notwendigen institutionalen Hintergrund vorbereiten werden, oder die Menschen umschulen und erst dann werden wir anfangen. Das Ergebnis war keine lineare Entwicklung des Wirtschaftswachstums, manchmal enttäuschte Erwartungen, eine scharfe Abgrenzung zwischen Gewinnern und Verlierern sowie eine Infragestellung der ganzen Transformationskonzepte und ihrer Realization durch die, die von Anfang an - aus unterschiedlichen Gründen - außen blieben.
Es gab auch ein tschechisches Spezifikum. Die außerordentliche politische und ökonomische Stabilität der Jahre 1990-97 führte nicht zum häufigen Wechsel von Regierungen und Ministerpräsidenten, wie es in allen anderen Ländern der Fall war. Daher war es so einfach, den “Transformationssündebock” zu finden.
Freiheit, Demokratie und Markt sind sehr leicht verletzlich. Bemühen wir uns darum, daß diese drei Worte ein Grundmotto für das beginnende 21. Jahrhundert bleiben. Und dies in beiden Teilen Europas.
Václav Klaus, Walter Eucken Institut, Freiburg, 31. August 2000
- hlavní stránka
- životopis
- tisková sdělení
- fotogalerie
- Články a eseje
- Ekonomické texty
- Projevy a vystoupení
- Rozhovory
- Dokumenty
- Co Klaus neřekl
- Excerpta z četby
- Jinýma očima
- Komentáře IVK
- zajímavé odkazy
- English Pages
- Deutsche Seiten
- Pagine Italiane
- Pages Françaises
- Русский Сайт
- Polskie Strony
- kalendář
- knihy
- RSS
Copyright © 2010, Václav Klaus. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných na tomto serveru.