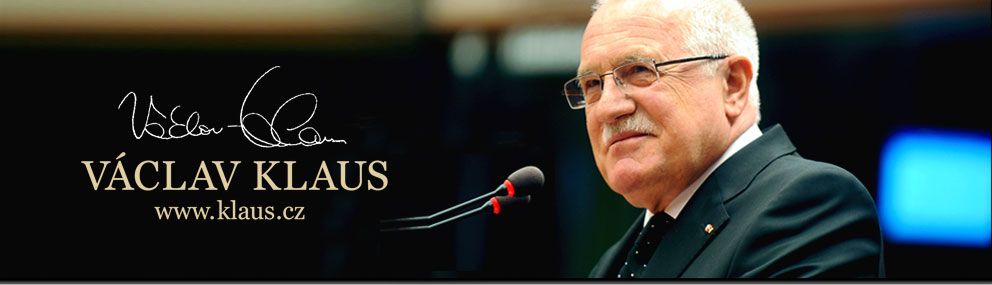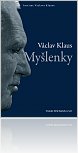Nejnovější
- Václav Klaus pro iDNES: SMS považuji za nešťastné, ale žádné vydírání to není
- Ivo Strejček: Pražský hrad jako centrum opoziční politické moci
- Ladislav Jakl: Kapitalismu je 35. Všechno nejlepší a dlouhá léta
- Václav Klaus pro Protiproud: O střetu Hradu s vládou 35 let po spuštění kapitalismu
- Budoucnost Evropy v éře dnes probíhajících geopolitických posunů
Nejčtenější
- Václav Klaus pro XTV: „Evropské elity zbortily Trumpův mírový plán, totálně podléhají Zelenskému"
- Ivo Strejček: Domýšlí Petr Pithart svá slova?
- Václav Klaus pro iDNES: SMS považuji za nešťastné, ale žádné vydírání to není
- Václav Klaus pro Protiproud: O střetu Hradu s vládou 35 let po spuštění kapitalismu
- Ivo Strejček: Kvadratura grónského kruhu a český zájem
Hlavní strana » Deutsche Seiten » Interview des Präsidenten der…
Interview des Präsidenten der Tschechischen Republik für die Wochenzeitschrift Der Spiegel
Deutsche Seiten, 13. 3. 2006
Herr Präsident, Sie sind einer der schärfsten Euro-Kritiker. Sie halten die Europäische Union für ein dirigistisches, bürokratisches Gebilde – kurzum: für ein undemokratisches Monstrum. Tschechien aber gehört jetzt selbst seit zwei Jahren zur EU. Hat die Mitgliedschaft Ihrem Land geschadet?
Das habe ich nie gesagt. Ich habe immer gesagt, die Tschechische Republik ist ein wichtiger Teil Mitteleuropas. Wir müssen an der europäischen Integration teilnehmen, das ist ganz klar. Ich bin ganz sicher, dass die Tschechische Republik – oder damals die Tschechoslowakei – ohne den kommunistischen Putsch von 1948 zu den Gründungsmitgliedern der EU gehört hätte. Meine Kritik zielt auf die Form und die Methoden der europäischen Integration.
In der Diskussion um die EU-Verfassung haben Sie gesagt, Sie hätten „Angst um Europa“. Franzosen und Niederländer haben das Projekt inzwischen platzen lassen. Empfinden Sie Genugtuung darüber?
Leider nicht. Zufrieden war ich nur in den ersten Minuten, nachdem die Entscheidung bekannt geworden war. Jetzt sehe ich, dass wir schon wieder in einer gefährlichen Situation sind. Ich beobachte, dass die Vertiefung der EU leider auch ohne Verfassung weitergeht, als ein schleichender Prozess der Vereinheitlichung – und das ist noch viel gefährlicher. Es ist sehr schwierig, diesen Prozess zu bremsen, er wird ohne große öffentliche Anteilnahme vorangetrieben.
Sehen Sie da nicht zu schwarz? Die österreichische Ratspräsidentschaft wird demnächst wohl einen Fahrplan zum weiteren Umgang mit der Verfassung vorstellen…
Die Verfassung war gedacht, um einen Sprung im Einigungsprozess zu machen. Er ist gescheitert. Anhänger eines vereinigten Europa waren in den ersten Tagen danach erschrocken und wie gelähmt. Dann aber haben sie schnell verstanden, dass sie ihre ursprünglichen Ziele und Absichten weiter verfolgen können, auch ohne Verfassung. Jeden Tag kommen nun weitere neue Gesetze, neue Initiativen, neue Richtlinien aus Brüssel, die uns in Richtung Vereinheitlichung drängen.
Welches Signal aus Brüssel hat Sie denn in letzter Zeit besonders gestört?
Es geht nicht um eine einzelne Entscheidung, die besonders gefährlich wäre. Es sind hunderte von Beschlüssen, die uns jeden Tag aus der EU-Zentrale erreichen. Für besonders bedenklich halte ich zum Beispiel das Gerede über eine mögliche Steuerharmonisierung in Europa oder die ausgebremste Liberalisierung bei den grenzüberschreitenden Dienstleistungen. Ich habe jüngst meinen Ohren nicht getraut, als ich hörte, dass unser eigener Kommissar Vladimir Spidla eine für mich unglaubliche Sache vorgeschlagen hat: einen EU-Fonds für die Opfer der Globalisierung. Das ist Kommunismus in Reinkultur – wie zu Breschnews Zeiten. Damals waren die Menschen ebenfalls dazu verurteilt, aus der Zeitung zu erfahren, was die da oben an der Spitze für sie beschlossen hatten. Ich erinnere mich noch sehr gut an dieses Gefühl der Ohnmacht.
Sie kritisieren das Demokratie-Defizit, die zunehmende Distanz zwischen der politischen Elite und dem Volk?
Ja, aber mir geht es vor allem um die politische Dimension der europäischen Integration. Die ist für mich einer der allerwichtigsten Punkte – das hängt mit unserer Vergangenheit zusammen, mit unserer Empfindlichkeit, ja vielleicht sogar Überempfindlichkeit in dieser Hinsicht.
Sie nennen sich einen Euro-Realisten. Was dürfen wir darunter verstehen?
Es ist der Gegenteil zum Euro-Naiven. Ich bin kein Euro-Skeptiker oder EU-Gegner.
Was zeichnet denn einen Euro-Naiven aus?
Das ist nicht nur einer, der passiv und unkritisch alles, was aus Brüssel kommt, gutheißt. Euro-Naive sind auch jene Leute, die diesen schleichenden Vereinheitlichungsprozess vorantreiben, im Europa-Parlament, in der Brüsseler Bürokratie, in der Kommission. Kaum jemand, der nicht professionell mit Politik zu tun hat, kennt die Namen der EU-Kommissare oder etwa den des EU-Parlamentspräsidenten. Aber diese Leute erlangen immer mehr Gewicht, während die Bedeutung der nationalen Parlamente immer weiter abnimmt.
Ihre Fundamentalkritik steht in merkwürdigem Kontrast zur hohen Anziehungskraft, die die EU in den letzten 15 Jahren auf viele Menschen gerade in Osteuropa ausübte. Hat die Europäische Union denn nicht gerade dort die Demokratie vorangebracht?
Nein, die EU hat unsere Demokratie um keinen Millimeter vorangebracht.
Wir denken zum Beispiel an die Slowakeit, wo Präsident Meciar abgewählt wurde…
Aber das haben die Slowaken selbst getan; solch einen Prozess von außen voranzutreiben, ist für mich unakzeptabel. Unsere Demokratie haben wir selber geschaffen. Im übrigen ist die EU-Mitgliedschaft keine Frage der Anziehungskraft: Es gibt einfach keine Alternative zu ihr. Denn diese Mitgliedschaft war für die betreffenden Länder eine wichtige politische Anerkennung. In Europa gilt die Regel: Die Guten sind in der EU, die Bösen nicht.
Aber hat die EU nicht Prozesse angestoßen, die sonst nicht so schnell in Gang gekommen wären? Zum Beispiel die Herausbildung eines neuen Rechtssystems? Die Kandidatenländer Bulgarien oder Rumänien tun jetzt alles, um mit einer Polizei- und Justizreform EU-Standards zu genügen.
Die Bulgaren und Rumänen sind schon von sich aus an einer normalen, freien, demokratischen Gesellschaft interessiert. Sie brauchen dazu keine Berater. Wir haben unsere Demokratie für uns selbst entwickelt – und nicht für die blauen Augen von irgendjemandem in Brüssel.
Sie sind gegen soziale Mindeststandards in Europa, gegen eine gemeinsame Steuerpolitik. Wäre eine gemeinsame Außenpolitik für sie genauso abwegig?
Eine gemeinsame Außenpolitik ist für mich völlig unnötig. Die verschiedenen europäischen Länder haben ganz unterschiedliche Prioritäten, Ziele, Vorurteile. Es wäre falsch, sie alle auf einen gemeinsamen Kurs zu drängen. Sehen Sie sich doch das Ergebnis der Volksabstimmungen in Frankreich und den Niederlanden an. Beide Länder haben die Verfassung aus ganz unterschiedlichen Motiven abgelehnt. Und das ist in Ordnung. Es kann doch nicht jemand kommen und uns zwingen, eine einheitliche Hemdgröße zu kaufen – obwohl der eine Kragenweite 39 braucht und der anderen 41.
Sie lassen kaum ein gutes Haar an der EU. Wie weit sollte die Integration denn ihrer Meinung nach gehen?
Man kann die Entwicklung der europäischen Integration in zwei Phasen aufteilen: Die erste Ära reicht bis zum Vertrag von Maastricht. Das war eine Liberalisierungsphase, das Hauptprinzip der europäischen Integration war damals die Beseitigung verschiedener Barrieren und Grenzen in Europa. Dafür war ich zu hundert Prozent.
Die Phase danach dagegen ist eine Homogenisierungs- oder Standardisierungsphase, eine Phase der Regulierung von oben, der zunehmenden Kontrolle unseres Lebens. Das hat für mich nicht mehr mit Freiheit und Demokratie zu tun.
Viele hatten ja nach dem Verfassungsdebakel das Ende der EU prophezeit, eingetreten ist es offenbar nicht.
Das waren Unkenrufe einiger Euro-Bürokraten und -Lobbyisten. Wir wissen doch alle, dass solch ein Ende gar nicht bevorstand. Die europäische Verfassung war ein Schritt von vielen, und man sollte nicht versuchen, sie nun wiederzubeleben.
Bei ihrer Rigorosität ist es kein Wunder, dass Ihnen die regierenden Sozialdemokraten vorwerfen, eine Art Nebenaußenpolitik am Kabinett vorbei zu betreiben…
Ach, das ist eine politisches Spiel unseres Ministerpräsidenten. Die Sozialdemokraten waren vor zehn Jahren gegen die EU, aber meine Partei, die Bürgerunion, war bereits 100 Prozent dafür.
Ihr russischer Kollege, Wladimir Putin, war dieser Tage gerade hier in Prag. Es fiel auf, wie sehr Sie sich mit Kritik an seiner Tschetschenien-Politik zurückgehalten haben – war das ein Entgegenkommen nach Putins kritischer Bewertung des sowjetischen Einmarsches 1968 in die CSSR?
Ich bin nicht sicher, ob es für Tschetschenien eine einfache Lösung gibt. Wir sehen doch in Bosnien-Herzegowina oder dem Kosovo, dass Einmischung von außen nur sehr wenig geholfen hat, zumindest aber keine stabile Lösung gebracht hat. Ich fürchte, dass niemand in Europa einen realistischen Entwurf in Sachen Tschetschenien machen kann. Ich höre immer nur moralisierende Kritik an der russischen Seite. Das ist doch billig. Deswegen weigere ich mich auch, Offene Briefe zu diesem Thema zu unterzeichnen…
… wie es gerade Ihr Vorgänger Vaclav Havel getan hat. Ist es denn richtig, wenn die deutsche Regierung sagt, Entwicklung in Russland sei zwar nicht sonderlich demokratisch, aber schaffe doch zumindest Stabilität. Ist das auch ihre Position?
Man darf natürlich kein Auge zudrücken. Wir müssen sehr aufmerksam sein. Aber wie kann man die Transformation der Gesellschaft in einem so großen Land wie Russland beschleunigen? Diejenigen, die da moralisieren, wollen von außen ihre Maßstäbe diktieren. Das geht natürlich auch nicht. Man kann Demokratie nicht von jenseits der Ländergrenzen verordnen, das haben wir doch selber erlebt in kommunistischen Zeiten: die Ostpolitik, der Helsinki-Prozess – das alles hat uns doch nicht wirklich geholfen.
Das sehen viele im Westen anders. Uns scheint überdies, dass das deutsch-tschechische Verhältnis noch immer etwas angespannt ist. Im letzten Wahlkampf vor vier Jahren wurde die antideutsche Karte gespielt. Fürchten sie, dass es dazu wieder kommt, wenn Tschechien im Sommer ein neues Parlament wählt?
Was? In Tschechien gab es anti-deutsche Töne? Das muss ich 100-prozentig zurückweisen. Das haben nur einige deutsche Politiker und Journalisten so konstruiert.
Aber der damalige Ministerpräsident Milos Zeman hat doch mitten im Wahlkampf plötzlich von den Sudetendeutschen als der Fünften Kolonne Hitlers schwadroniert.
Was ist daran anti-deutsch? Das ist der Versuch, die Situation in der Tschechoslowakei in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg zu beschreiben, zwischen 1935 und 1938. Das sind keine anti-deutschen Töne. Wie können Sie so etwas sagen?
Dennoch klang damals im Wahlkampf deutlich durch, dass die Deutschen zwar als Partner, aber ein durchaus bedrohlicher Partner gesehen werden. Ist das heute immer noch so?
Die menschlichen Beziehungen sind nun mal schwieriger, wenn ich es mit jemandem zu tun habe, der 30 Kilo mehr wiegt. Dann habe ich natürlich die Sorge, dass auch eine gut gemeinte Geste Komplikationen bringen kann. Mit Ländern wie Madagaskar oder Bolivien haben wir natürlich keine Probleme. Aber Deutschland ist unser Nachbar, es gibt die gemeinsame Vergangenheit, Deutschland ist stark und ehrgeizig und achtmal so groß wie wir. Es ist ganz logisch, dass wir vorsichtig agieren. Das ist einfach nur Realpolitik.
Im vergangenen Sommer hat sich die tschechische Regierung symbolisch bei jenen aus Tschechien vertriebenen Sudetendeutschen entschuldigt, die gegen Hitler gekämpft hatten – eine Geste, die damals in Deutschland viel beachtet wurde. Aber selbst die ging ihnen noch zu weit.
Ich habe kritisiert, ein paar linksorientierte Antifaschisten und Kommunisten herauszusuchen und sich bei denen zu entschuldigen. Es gab unter den Deutschen viele, die nicht Faschisten waren. Das war eine absolut falsche Idee, eine parteipolitische Idee. Ich bin gegen solche unaufrichtigen Gesten.
Aber ohne eine Aufarbeitung der Vergangenheit…
Die Vergangenheit ist Vergangenheit. Derzeit fordert die EU von der Türkei eine Geste zum Genozid an den Armeniern 1915. Wem würde das helfen? Präsident Putin hat sich jetzt für die Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 entschuldigt. Das war eine gute Geste. Aber ich bin nicht der Meinung, dass ich heute mit Putin darüber reden muss, was Breschnew 1968 getan hat. Putin ist nicht Breschnews Erbe, und ich bin nicht der Erbe der kommunistischen Regierung, die 1948 in der Tschechoslowakei die Macht übernahm.
Herr Präsident, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
Christian Neef, Jan Puhl, Der Spiegel, 13.3.2006
- hlavní stránka
- životopis
- tisková sdělení
- fotogalerie
- Články a eseje
- Ekonomické texty
- Projevy a vystoupení
- Rozhovory
- Dokumenty
- Co Klaus neřekl
- Excerpta z četby
- Jinýma očima
- Komentáře IVK
- zajímavé odkazy
- English Pages
- Deutsche Seiten
- Pagine Italiane
- Pages Françaises
- Русский Сайт
- Polskie Strony
- kalendář
- knihy
- RSS
Copyright © 2010, Václav Klaus. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných na tomto serveru.