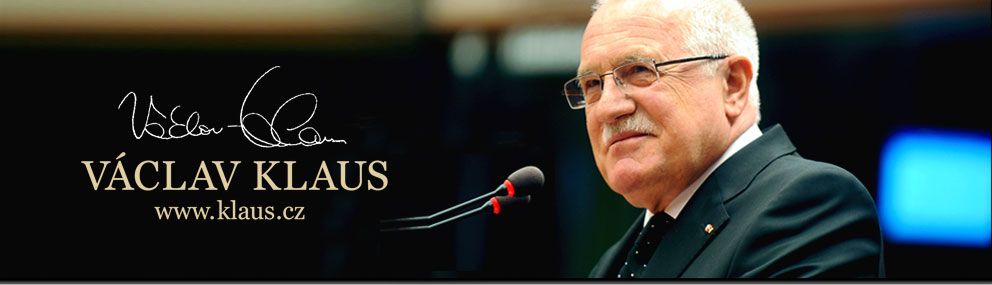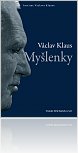Nejnovější
- Páteční glosa IVK: Podceňovaná negativní stránka digitalizace
- Přání Václava Klause k 90. narozeninám Jana Klusáka
- Václav Klaus na CNN Prima News o své nové knize "Dílčí reformy jsou málo, řešením je systémová změna"
- Václav Klaus ve 50. díle pořadu XTV: Pane prezidente!
- Zdravice Václava Klause pro volební sněm SPD
Nejčtenější
- Milan Knížák: Injekce pro Ameriku
- Václav Klaus představil svou studii k potřebě systémové změny české ekonomiky
- Václav Klaus k vítězství Petera Pellegriniho v prezidentských volbách na Slovensku
- Václav Klaus: Dílčí reformy jsou málo – řešením je systémová změna
- Jiří Weigl: Slovenské volby a česká politika
Hlavní strana » Deutsche Seiten » Gefahr des aggressiven…
Gefahr des aggressiven Keynesianismus der zweiten Generation
Deutsche Seiten, 18. 5. 2009
Über Jahrhunderte und Jahrtausende findet eine langsame evolutionäre Entwicklung statt, die die ganzen vorherigen Erfahrungen der Menschheit erfasst und in gewissem Maße auch erhält. Einige Ereignisse führen aber dazu, dass diese Entwicklung vorgeschoben oder beschleunigt wird. Ich möchte behaupten, dass wir gerade heute in einer Zeit leben, die in wesentlichen Aspekten eine Folge, ja sogar ein Produkt der großen Krise der 1920er und 1930er Jahre ist – bzw. eine Folge dessen, wie diese Krise interpretiert wurde.
Die Krise wurde als Beweis dafür genommen, dass die damalige Form des Kapitalismus nicht weiter bestehen kann, was zu weitgreifenden Eingriffen in das Funktionieren und in Institutionen dieses einzigartigen, aber zerbrechlichen und verletzlichen gesellschaftlichen Systems führte.
Der Kapitalismus hatte immer seine Kritiker. Er hatte seinen Marx (und eine ganze Reihe Anderer), immer war es jedoch eine Kritik von außen und mit Ausnahme der Entstehung der Sowjetunion (und ihrer Satellitenstaaten) war diese Kritik nie der definierende Bestandteil des Systems selbst. Niemals wurde sie von der Mehrheit als Ausgangspunkt für radikale Veränderungen der Gesellschaftsordnung akzeptiert (hier spreche ich von der westlichen Welt).
In den 1930er Jahren war dies anders. Damals entstand eine szientistisch erscheinende Doktrin, formuliert zudem nicht von einem Outsider, sondern von einer wichtigen Persönlichkeit des damaligen Establishments der Wirtschaftswissenschaft (Universität Cambridge), des kulturellen Lebens (Londoner Bloomsbury-Gruppe), der Wirtschaftspolitik (bedeutende Funktionen auf wichtigen internationalen Konferenzen nach dem 1. und 2. Weltkrieg) – John Maynard Keynes. Dieser attraktiven, leicht verständlichen und leicht politisch durchsetzbaren Doktrin wurde bald Glauben geschenkt. Man glaubte ihr über lange Jahrzehnte, mindestens bis Anfang der 1970er Jahre, als die Kumulation der damaligen wirtschaftlichen Probleme zum Entstehen des – für Keynesianer unerklärlichen – Phänomens der Stagflation führte (Stagflation als Verbindung der Wörter Stagnation und Inflation).
Mit seinem genialen Gespür traf Keynes voll die gesellschaftliche Nachfrage. Es gelang ihm, den Kapitalismus überzeugend genug zu desinterpretieren (und schaffte dies durch eine Karikatur des bedeutenden klassischen Ökonomen Jean-Baptiste Say auch für die gesamte bis dahin bestehende Wirtschaftswissenschaft) und den Ökonomen, Politikern und Medien die Überzeugung aufzudrängen, dass ein rasantes Eingreifen des Staates in die Wirtschaft in Form von umfangreichen „staatlichen Ausgaben“ zur Ergänzung der inhärent ungenügenden „effektiven Nachfrage“ von uns allen in unserer Rolle als Verbraucher oder Investoren, die einzige mögliche Zukunft für den Kapitalismus sein kann. Keynes war immer ein Elitist und dachte deshalb, dass der Staat (vertreten durch aufgeklärte Persönlichkeiten wie er selbst) das Geld der Steuerzahler besser ausgeben könnte als diese selbst. Er „spielte“ dramatisch mit dem Bild vom Versagen des Marktes, die Frage nach dem Versagen des Staates stellte er sich nie. Er war der Prototyp eines „Philosophen-Königs“, eines Phänomens, das seit der Wende auch bei uns relativ häufig anzutreffen ist. Dies ist jemand, der sich befugt fühlt andere zu leiten.
Ich werde jetzt – ganz absichtlich – nicht auf die außerordentlich interessante, schon Jahrzehnte andauernde Diskussion über die Unterschiede zwischen Keynes und dem Keynesianismus eingehen, die zu Büchern mit dem Titel „War Keynes ein Keynesianer?“ führte. Ich habe viele davon gelesen. Keynes Gedankengänge waren, wie es bei großen Persönlichkeiten so ist, breiter und tiefgehender, als es der abgeflachte Keynesianismus in den Lehrbüchern für Studierende des 1. Jahrgangs Volkswirtschaftslehre darstellt. Dem stimme ich voll zu. Aber, wie einer seiner großen Schüler und Nachfolger P. A. Samuelson erklärte, „zeigt sich die Kraft einer Doktrin am besten in ihrer Vulgarisierung“. Deshalb ist der Unterschied zwischen Keynes und Keynesianismus in unserer heutigen Diskussion unwichtig. (Der Ordnung halber möchte ich noch beifügen, dass Samuelson von Marx sprach.)
Keynes’ Prämisse lautete: der Markt hat versagt und deshalb muss der Staat antreten. Deshalb also massive staatliche Ausgaben jeder Art. Hier ist anzumerken, dass es Keynes vor allem um den so genannten Multiplikator ging. Dieser führt zu neuen Einkommen, zur Steigerung des Nationaleinkommens, nicht jedoch zur Schaffung neuer Produktionskapazitäten. Daher seine Betonung der Einkommenseffekte, nicht Kapazitätseffekte zusätzlicher Ausgaben. Daher stammt auch seine berühmte Metapher, dass es ausreiche Geldscheine in Flaschen zu stecken, diese zu vergraben und nach einiger Zeit wieder aufzugraben. Der Multiplikator „arbeitet“, obwohl es sich um eine nicht produktive Tätigkeit handelt. (Als wir Mitte der 1960er Jahre darüber im Ökonomischen Institut der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften darüber erstmals diskutierten, kamen wir gleich auf den Gedanken, dass der erste Keynesianer wohl Karl IV. gewesen war, als er seine „Hungermauer“ auf dem Prager Laurenziberg bauen ließ.) Deshalb also die Finanzierung des Staatshaushalts durch Defizite. Deshalb die Regulierung der Wirtschaft. Deshalb die Verstaatlichung. Deshalb staatliche Interventionen jetzt, egal welche langfristigen Auswirkungen damit verbunden sind. Keynes’ „in the long run, we are all dead“ sagt alles.
Der Keynesianismus bzw. die darauf basierte Politik hat in den westlichen Staaten gesiegt. Vergleichen wir den Anteil der Staatsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 1930 und im Jahr 2000, ist der Unterschied enorm. Vergleichen wir die Steuerquote, wieder ein großer Unterschied (dabei sollten wir das Jahr 1930 eher mit 1980 vergleichen, d. h. mit der Welt von R. Reagan und M. Thatcher). Das Gleiche gilt für den Vergleich der Staatsverschuldung. Vergleichen wir die damalige und heutige Höhe der Sozialeinkommen mit anderen Einkommen, sehen wir wieder eine enorme Differenz. Dasselbe gilt für die Zahl der staatlichen Beamten. Dasselbe gilt für den Umfang der Gesetzestexte.
All dies funktioniert auch als so genannter „Ratchet-Effekt“ (Sperrklinkeneffekt). Demnach ist die Bewegung nur in einer Richtung möglich, immer „nach vorn“, auch wenn es sich um einen sehr fiktiven Fortschritt handelt. Eher um einen Rückschritt. Es zeigt sich, dass die entgegengesetzte Bewegung nur in einem „revolutionären“ Augenblick durchgesetzt werden kann, wie er zum Beispiel beim Fall des Kommunismus bestand. Damals haben wir den Staat radikal abgebaut (auch wenn es damals viel Arbeit gemacht hat), aber seit jener Zeit haben wir uns – teils als Folge der Wandlungen in der Innenpolitik, insbesondere jedoch als Import aus der Europäischen Union – diesem globalen Trend angeschlossen. Die Politik der Deregulierung, Deetatisierung, Denationalisierung, Desubsidierung der Wirtschaft endete bei uns in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre. Die erste Dekade des einundzwanzigsten Jahrhunderts bedeutete den vollständigen Sieg des Sozialdemokratismus in verschiedensten Maskierungen (eine davon ist der europäische Christdemokratismus), anders ausgedrückt den Sieg des Keynesianismus. Gerade dies war in der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahren entstanden.
Auch jetzt sehen wir eine Krise, die größer ist als die Krisen der vergangenen Jahrzehnte (auch wenn z. B. der Fall des Kommunismus, der überhaupt nicht mit dem Keynesianismus zusammenhing, zu viel größeren ökonomischen Verlusten als die heutige Krise geführt hat). Vor einigen Monaten habe ich diese Krise mit einer Grippe verglichen, was großen Unwillen hervorgerufen hat. Ich bestehe darauf, dass die heutige Krise, wenn wir schon medizinische Terminologie benutzen, eher eine Grippe als Krebs, die Pest, AIDS oder ein Herzinfarkt. Zudem habe ich diesen Vergleich mit einer anderen Absicht verwendet. Ich sagte, eine Grippe dauert eine Woche, wenn sie nicht behandelt wird, und sieben Tage, wenn sie behandelt wird, anders gesagt habe ich damit mein großes Misstrauen über die Möglichkeit der Heilung der Krise durch „Geldinfusionen“ des Staates zum Ausdruck gebracht. Mit diesem Vergleich wollte ich die Auswirkungen dieser Krise nicht herunterspielen, wie es mir wiederholt nachgesagt wird. Die Krise muss – leider – stattfinden. Sie ist ein Gesundungsprozess. Sie ist die notwendige und durch nichts zu ersetzende Liquidation von nicht haltbaren wirtschaftlichen Aktivitäten. Es ist unvernünftig, diese Aktivitäten künstlich aus den Geldern der Steuerzahler zu erhalten.
Man könnte sich auch mit der Analyse der Ursachen der heutigen Krise befassen, dies ist jedoch nicht das Ziel dieses Textes. Eher sollte gesagt werden, was nicht zu dieser Krise geführt hat. Sicher war es nicht Keynes’ mangelnde „effektive Nachfrage“, der ungenügende Verbrauch bzw. ungenügende Investitionen. Deshalb kann sie auch nicht durch die Stärkung jener mangelnden effektiven Nachfrage durch den Staat nach Keynes’ Rezepten überwunden werden. Die Krise entstand durch ehrgeizige, jedoch irrationale staatliche Eingriffe in die Zinssätze und in den Umfang des Geldangebots in den USA, begleitet von einer fehlerhaften Regulierung des Finanzsektors. Unverhältnismäßig niedrige Zinssätze für Hypotheken führten zu einem Ungleichgewicht, das beseitigt werden muss und nicht durch Zufluss weiterer Gelder künstlich erhalten werden darf. Die Blase muss platzen, sie darf nicht noch weiter „aufgeblasen“ werden. Aber das ist wirklich nicht das Thema dieses Artikels.
Früher oder später wird die Krise überwunden sein. Ein langfristiger Schaden wird länger dauern. Gegnern des Marktes gelang es, ein großes Misstrauen in das System hervorzurufen. Dieses Mal ist die Kritik jedoch nicht gegen den Kapitalismus des freien Marktes, gegen Laissez-faire, gegen den Kapitalismus von Adam Smith, Friedrich von Hayek, Milton Friedman wie vor 70 – 80 Jahren gerichtet. Die Kritik richtet sich heute gegen den schon sehr stark regulierten, verstaatlichten Kapitalismus der Gegenwart. Die heutigen Kritiker erwecken den Anschein, dass das heutige System gar nicht reguliert ist, als ob es nicht unter einer immensen Beeinflussung des Staates ist, als ob es sich wirklich um ein System der Art „free market“ handeln würde, dies ist aber nicht wahr. Heute sind wir ganz woanders. Die gegenwärtigen sozialistischen „Visionäre“ deuten – trotz ihrer häufig abweichenden Rhetorik – an, dass ihnen auch dieser verstaatlichte Kapitalismus noch nicht genug ist. Die keynesianische Revolution ist ihnen nicht genug. Sie wollen eine weitere Revolution – den Markt noch mehr einschränken.
Langsam kommen wir dem realen Sozialismus immer näher. Der Markt wird nicht als autonomes System betrachtet, sondern als ein Instrument – in Händen Auserwählter – zur Herstellung ökonomischer Güter. In diese Richtung gehen Äußerungen wie „die Wirtschaft muss den Menschen dienen“, „Finanzsystem im Dienste der Menschheit“ usw. Die Autoren dieser Äußerungen nenne ich lieber nicht, die Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaft Stiglitz und Krugman sprechen jedoch sehr ähnlich.
Ich bin mir nicht sicher, ob der Kapitalismus eine solche radikale Veränderung überlebt. Den Markt gibt es, oder es gibt ihn nicht. Der Markt ist kein Instrument, wie es die Zentralplaner glauben wollten, als auch sie verstanden, dass es nicht ganz ohne Markt geht. Sie wollten den Markt deshalb nutzen – der Markt lässt sich jedoch nicht nutzen. Der Markt ist das Ergebnis einer freiwilligen menschlichen Aktivität, bei der Menschen – in ihrem ureigensten Interesse – Anderen etwas anbieten, was sie besser als jene können und wo sie einen komparativen Vorteil haben. Das Angebot von Waren und Dienstleistungen ist das Ergebnis des Funktionierens des Marktes. Ohne Markt kann es keinerlei Produktion von Waren und Dienstleistungen geben. Die Produktion von Waren und Dienstleistungen besteht nicht neben dem Markt, sie ist der Markt selbst. Die heutige Krise hat nicht der Markt verursacht, sondern Eingriffe des Staates in den Markt. Deshalb können auch keine zukünftigen Krisen infolge weiterer staatlicher Eingriffe in den Markt ausgeschlossen werden. Der Markt kann vernichtet werden, gerade in Europa sind wir nicht weit davon entfernt.
Erste Aufgabe unserer Zeit ist nichts anderes, als den Keynesianismus der „zweiten Generation“ nicht zuzulassen. Die 1930er (und folgenden) Jahre dürfen wir nicht wiederholen. Wir müssen staatliche Eingriffe in die Märkte einschränken, nicht erweitern. Ich weiß jedoch nicht, wie das erreicht werden kann. Eine tatsächliche Demokratie würde vielleicht einen solchen Schritt erlauben. Vielleicht. Ich bin mir jedoch sicher, dass die heutige europäische Postdemokratie nicht dahin führen kann. Die Stimme des Bürgers ist darin außerordentlich schwach und wird von Tag zu Tag schwächer und schwächer. Dem hingegen steigt unhaltbar die Macht nicht gewählter Bürokraten, denen der Markt eher ein Dorn im Auge ist.
Die Demokraten und Liberalen (im europäischen Sinne) versagten in den 1930er Jahren intellektuell und politisch und konnten das aufkommende Misstrauen in den Markt nicht abwenden. Heute geht es einzig und allein darum, dass es uns nicht ähnlich oder sogar noch schlimmer ergeht.
Václav Klaus
(In verkürzter Form publiziert in der WirtschaftsWoche, 18. Mai 2009.)
- hlavní stránka
- životopis
- tisková sdělení
- fotogalerie
- Články a eseje
- Ekonomické texty
- Projevy a vystoupení
- Rozhovory
- Dokumenty
- Co Klaus neřekl
- Excerpta z četby
- Jinýma očima
- Komentáře IVK
- zajímavé odkazy
- English Pages
- Deutsche Seiten
- Pagine Italiane
- Pages Françaises
- Русский Сайт
- Polskie Strony
- kalendář
- knihy
- RSS
Copyright © 2010, Václav Klaus. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných na tomto serveru.