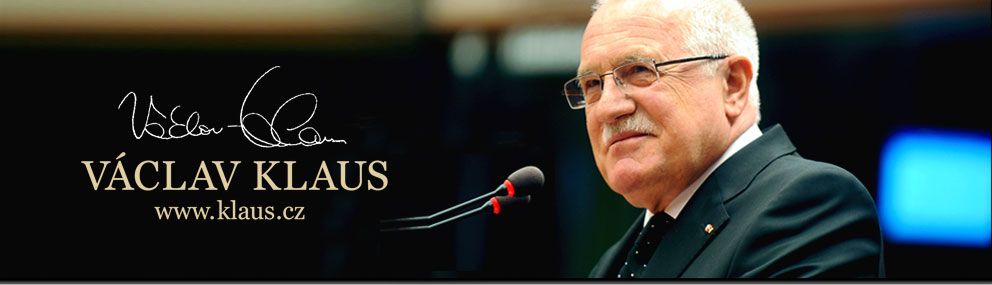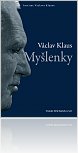Nejnovější
- Přání Václava Klause k 90. narozeninám Jana Klusáka
- Václav Klaus na CNN Prima News o své nové knize "Dílčí reformy jsou málo, řešením je systémová změna"
- Václav Klaus ve 50. díle pořadu XTV: Pane prezidente!
- Zdravice Václava Klause pro volební sněm SPD
- Václav Klaus představil svou studii k potřebě systémové změny české ekonomiky
Nejčtenější
- Milan Knížák: Injekce pro Ameriku
- Václav Klaus představil svou studii k potřebě systémové změny české ekonomiky
- Václav Klaus k vítězství Petera Pellegriniho v prezidentských volbách na Slovensku
- Václav Klaus: Dílčí reformy jsou málo – řešením je systémová změna
- Jiří Weigl: Slovenské volby a česká politika
Hlavní strana » Deutsche Seiten » Europa und Mitteleuropa:…
Europa und Mitteleuropa: Wohin geht der Weg?
Deutsche Seiten, 31. 3. 2010
Zunächst möchte ich für die Einladung zu einem Vortrag vor diesem Gremium danken. Sie haben mich schon bei früheren Gelegenheiten eingeladen, aber ich habe immer eine mit meinem »Präsidentenamt« zusammenhängende Entschuldigung vorgeschoben. Aber es ist schön, endlich hier sein zu können.
Ich habe in den neunziger Jahren an vielen Konferenzen über wirtschaftliche Probleme in Mittel- und Osteuropa teilgenommen. Damals hatte der Begriff Mittel- und Osteuropa eine besondere Bedeutung, er bedeutet eine einmalige, wahrhaft historische Aufgabe, er wirkte geistig anregend auf Nationalökonomen und Sozialwissenschaftler, sowie im wirtschaftlichen Sinne auf potentielle Investoren und Geschäftsleute. In dieser Region fand man verhältnismäßig günstige Investitionsmöglichkeiten, enorme und schnelle Profite, umfassende Privatisierungen. Wir wünschten uns mehr ausländische Geschäftspartner und Investoren, und das war für uns auch Grund genug, bei diesbezüglichen Konferenzen das Wort zu ergreifen.
Heute ist alles ganz anders. Man kann feststellen, dass Mittel- und Osteuropa nicht mehr als ein Spezialterritorium anzusehen ist. Der Systemwechsel vom Kommunismus zur freien Gesellschaft ist weitgehend vollendet, die meisten dieser Länder sind heute Mitglieder der EU und der NATO und haben sowohl eine parlamentarische Demokratie als auch eine Marktwirtschaft.
Die mittel- und osteuropäischen Länder sind in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung zwar nicht so weit wie die meisten westeuropäischen Staaten, aber ich glaube nicht, dass sie das in irgendeinem Sinne zu einem Sonderfall macht. Der Unterschied im per- capita-BNP zwischen Österreich und der Tschechischen Republik ist nicht größer als der entsprechende Unterschied zwischen Irland und Portugal oder Griechenland, nicht zu reden von den Unterschieden zwischen Nord- und Süditalien oder zwischen Paris und dem ländlichen Frankreich.
Einzelne restliche Privatisierungsfälle in einigen Ländern mögen für manche von Ihnen noch einen Anreiz darstellen, aber die Ära der umfassenden Privatisierung ist vorbei. Zumindest in meinem Land gibt es nicht mehr viele Firmen, die zu privatisieren wären.
Der Grund für das Interesse an dieser Region mag die größere wirtschaftliche Freiheit in einigen dieser Länder gewesen sein, aber dieses Argument war in den neunziger Jahren zutreffender. Zu meinem Bedauern ist das heute nicht mehr so. Auf Grund der umfassenden Einführung von EU-Vorschriften ist die Region weniger frei als noch vor zehn Jahren.
Im Vergleich mit Westeuropa gibt es heute mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede. Die Staaten Mittel- und Osteuropas sind bereits »normale europäische« Länder geworden – ein zweifelhafter Segen. Ich bin in Bezug auf die heutige »europäische Normalität« eher unglücklich.
Ich hatte gehofft, dass wir einige der wohlbekannten europäischen Mängel und Fehler vermeiden könnten, da unsere Erfahrungen mit dem Kommunismus ausreichend Warnung gewesen waren – oder es sein hätten müssen. Ich dachte, dass wir nein sagen würden zur deutschen und österreichischen »sozialen Marktwirtschaft«, nein zum französischen linken Etatismus (der bis in die Zeit eines Colbert zurückreicht), nein zur britischen Labourbewegung – einer der vagen Spielarten des Dritten Wegs –, nein zum besonders großzügigen skandinavischen Paternalismus, nein zur aggressiven Umweltideologie eines Cohn-Bendit und Nein zum Brüsseler Europäertum. Ich dachte, wir würden den Weg zur klassischen parlamentarischen Demokratie und zur Marktwirtschaft beschreiten.
Das ist nicht geschehen. Wir haben diese europäischen Aspekte nicht ausklammern können, und das ist der Grund, warum wir nun die üblichen europäischen Probleme lösen sollen, aber leider häufig nicht lösen können, nämlich:
– das wirtschaftlich nicht vertretbare Ausmaß der Einkommensverteilung, welches zu hohen Steuern und einer enormen Machtfülle des Staates und seiner Repräsentanten führt;
– die unzureichende Produktivität des paternalistischen Wohlfahrtstaates, der die Menschen nicht zum Arbeiten motiviert;
– das Vorhandensein und die gefährliche Zunahme unzumutbarer Defizite bei den öffentlichen Ausgaben;
– die Überalterung der Bevölkerung, zusammen mit der Unbeweglichkeit und fehlenden Anpassungsfähigkeit der Pensionssysteme;
– die Unfähigkeit, ein praktikables System zur Finanzierung des immer kostspieliger werdenden Gesundheitswesens zu entwickeln, in dem die Kosten nicht vom Patienten, sondern von dritter Seite getragen werden;
– der Unmöglichkeit einer vernünftigen Finanzierung der Ausbildung, hervorgerufen durch künstliche und zumeist nutzlose Verlängerung der Studienzeiten auf Grund falscher Vorstellungen vom Bildungsbegriff. Die Folge ist die sinkende Qualität der Ausbildung;
– die nicht zu bewältigende und unkontrollierbare Masseneinwanderung, eine logische Folge der in Mode befindlichen und als politisch korrekt erachteten Begriffe eines Multikulturalismus und Menschenrechtlertums, sowie eines großzügigen europäischen Sozialsystems;
– die Schwächung, wenn nicht sogar das Verschwinden der Identifikation der Menschen in Europa mit dem entscheidenden, unabdingbaren, natürlichen und authentischen gesellschaftlichen Gebilde, genannt Nationalstaat (oder einem von einer vorherrschenden Nation geschaffenen Staat).
Jede dieser Tendenzen bedeutet eine direkte Gefahr für uns alle. Und das finde ich bestürzend. Das bringt mich nunmehr zur heutigen Finanz- und Wirtschaftskrise. Sie überraschte die meisten Nationalökonomen, alle Politiker und die gesamte Öffentlichkeit. Fast niemand hatte dergleichen erwartet. Die Menschen glaubten an die Allmacht der Zentralbanken und Regierungen, welche die Makroökonomie schon im Zaum halten würden, sowie an die Möglichkeit, die Rationalität und Produktivität einer mikroökonomischen Kontrolle, vor allem im Finanz- und Bankwesen. Als überzeugter Anhänger der österreichischen nationalökonomischen Schule muss ich feststellen, dass alle diese Leute auf den »Weg zur Sklaverei« geführt wurden, wie ihn der große österreichische Denker Friedrich von Hayek überzeugend dargelegt hat.
Der erwähnte Glaube sollte sich als falsch erweisen. Nationalökonomen begannen langsam die Ursachen der gegenwärtigen Krise zu begreifen, die infolge eines Zusammentreffens von Fehlentwicklungen entstanden war. Nach einer einfachen Ursache zu suchen, wäre der falsche Weg. Auf der makroökonomischen Ebene kommt man immer mehr zur Erkenntnis, dass der Beginn der Krise etwas zu tun hatte mit der beispiellosen Ausweitung weltwirtschaftlicher Diskrepanzen, mit der ungewöhnlich langen Periode niedriger Realzinssätze, mit der exzessiven Geldmenge und mit dem spekulativen Gebrauch von Pfandbriefen. Auf der mikroökonomischen Ebene wurde deutlich, dass die vorhandenen partiellen und äußerst mangelhaften Regeln hier nichts nützten. Im Gegenteil, sie verzerrten das rationale Kalkül von Banken und anderen Finanzinstitutionen und verleiteten sie dazu, nach anderen Auswegen zu suchen, nämlich mittels verschiedener »neuer Finanzprodukte«.
An dieser Stelle muss ausdrücklich vor Versuchen gewarnt werden, wieder einmal die Schuld für Probleme des Marktes im Marktsystem als solchem zu suchen. Die heutige Krise war nicht die Folge eines Marktversagens oder eines systemischen Fehlers des Kapitalismus. Es war ein Versagen des Staates infolge seines unangebrachten Ehrgeizes, auf grobe Weise in ein derart komplexes System einzugreifen, wie es Gesellschaft und Wirtschaft nun einmal sind. Man sollte Ludwig von Mises und Friedrich von Hayek eben immer wieder lesen. Die Krise wurde gewiss nicht von einem – von Keynes postulierten – Fehlen einer »effektiven Nachfrage« verursacht, d. h. zu wenig Konsum oder Investitionen von Seiten privater Wirtschaftsteilnehmer, und könnte daher nicht durch staatliche Eingriffe zwecks Nachfragesteigerung entsprechend dem Rezept von Keynes gelöst werden. Aktionen und Interventionen von Seiten des Staates verursachten, verlängerten und verschlimmerten die Krise auf dramatische Weise.
Früher oder später wird sie wohl vorbei sein. Allerdings, langfristig gesehen, wird sie fortdauern. Gegnern des Marktes ist es gelungen, ein weitreichendes Misstrauen gegenüber diesem System zu schaffen, aber diesmal nicht nur in Bezug auf den Marktkapitalismus, auf das laissez-faire-System, auf den Kapitalismus im Sinne von Adam Smith, Friedrich von Hayek und Milton Friedman, wie dies vor siebzig bis achtzig Jahren der Fall gewesen war, sondern in Bezug auf den weitgehend regulierten Kapitalismus von heute. Das ist jedoch bestürzend.
Mit ihrer kleinen und weitgehend offenen Volkswirtschaft konnte sich die Tschechische Republik gegenüber der offensichtlichen Verlangsamung der Weltwirtschaft und vor allem der Rezession bei unseren wichtigsten Handelspartnern weitgehend abschotten. Unser BNP ist im Jahre 2009 um etwa vier Prozent zurückgegangen.
Wir hatten insofern Glück, als unser Finanz- und Bankwesen vor der Krise nicht von allzu vielen faulen Krediten belastet wurde, was hilfreich war und immer noch ist. Überdies erwies sich unsere Währung als besonders vorteilhaft. Der Wechselkurs der tschechischen Krone fluktuiert nämlich, und ist daher nicht auf Dauer fixiert. Kleine, offene Marktwirtschaften, die den Euro übernahmen, oder mit dem Euro durch verschiedene, genau festgelegte monetäre Arrangements fix verbunden wurden, sind von der heutigen weltweiten Krise viel mehr erfasst worden. Das ähnelte sozusagen einem Laborversuch.
Die heutige Rezession bewies gleichzeitig die Richtigkeit des Lehrsatzes von der weitgehenden Korrelation zwischen dem Rückgang des BNP und des Steueraufkommens. In Bezug auf die Tschechische Republik sorge ich mich nicht so sehr wegen der Probleme ihrer Realwirtschaft und ihren Geschäftsfeldern. Die Wirtschaft wird sicherlich verhältnismäßig bald zu ihrer normalen Verhaltensweise zurückkehren. Allerdings bin ich besorgt wegen der Art und Weise sowie den Zeitpunkt, wenn man endlich beginnen wird, sich mit unseren Budgetproblemen zu befassen. Ich hoffe, dass die im Mai stattfindenden Parlamentswahlen die Bildung einer Regierung ermöglichen werden, die eine Lösung bringt oder zumindest die Tragweite dieses Problems und die möglichen Folgen erkennt.
Ein weiteres Thema, das ich heute anschneiden möchte, ist die Doktrin eines angeblichen Klimawechsels und ihre Auswirkungen auf die Gestaltung unserer Gesellschaften. Man bezeichnet das mit Recht als eine Doktrin, da ihre wissenschaftliche Grundlage mehr als dürftig ist.
Nachdem ich mich schon seit Jahren mit dieser Frage befasst habe und nachdem ich ein Buch mit dem Titel »Blauer Planet in grünen Fesseln« (Untertitel: »Was ist gefährdet: das Klima oder die Freiheit?«) veröffentlichte – das inzwischen in vierzehn Sprachen übersetzt wurde –, stelle ich fest, dass ich in Bezug auf das Klima keinerlei Problem sehe, weder zum jetzigen Zeitpunkt noch für die nähere Zukunft. Bei dem derzeitigen Disput geht es nicht um Temperatur und/oder den CO2-Ausstoß, sondern um eine neue utopische Weltanschauung. Es handelt sich um einen ideologischen Konflikt zwischen jenen, die nicht so sehr das Klima, sondern vielmehr uns ändern wollen, und jenen, die an die Freiheit, die Märkte, die Schaffenskraft des Menschen und an den technologischen Fortschritt glauben. Bei diesem Streit geht es um uns, um die Menschen, um eine menschenwürdige Gesellschaft, um unsere Werte, unsere Gepflogenheiten und um unseren Way-of-Life. Die Temperaturschwankungen sind für jene, die die dieses Spiel spielen, kein Thema echten Interesses, sondern bloß ein Vorwand.
Die verfügbaren Hinweise machen auf überzeugende Weise klar:
a) die von uns beobachtete Erwärmung ist kein globales Phänomen. Es zeigt sich in den kalten Regionen, nicht aber in den Tropen, in trockenen Gebieten, nicht in den feuchten, im Winter, aber nicht im Sommer, in den Nächten, aber nicht am Tage.
b) die Erwärmung ist nicht bedeutend. Die durchschnittliche weltweite Erwärmung betrug im vergangenen Jahrhundert nur 0,74° Celsius. Dazu kommt noch, dass die Klimaerwärmung vor mehr als zehn Jahren überhaupt aufgehört hat. Die heutigen Temperaturverhältnisse sind trotz einer enormen Zunahme der CO2-Emissionen etwa so wie im Jahre 1940.
c) die Erwärmung ist weder einzigartig noch beispiellos. Die Temperatur war in der mittelalterlichen Wärmeperiode und vielen anderen historischen Zeitabschnitten höher als heute.
d) die von uns erlebte milde Erwärmung wird nicht primär vom Menschen oder dem CO2 verursacht. Es gibt noch viele andere Faktoren, welche die Temperatur und das Klima beeinflussen; das ganze, äußerst komplexe Klimasystem ist immer noch von vielen größeren Unwägbarkeiten geprägt.
Das Wirtschaftswachstum durch Verteuerung zu blockieren – und dies ist das eigentliche Ziel der Umweltideologie mitsamt ihren alarmierenden Klimaprognosen – ist eine falsche und unannehmbare Strategie. Wir müssen dem mit aller Entschlossenheit entgegentreten. Die Geschichte lehrt uns, dass vermehrter Wohlstand und die unbehinderte Entwicklung der Technik unsere Fähigkeit zur Bewältigung aller möglichen Probleme, einschließlich potentieller Klimaschwankungen, enorm steigern. Wir müssen an die Anpassungsfähigkeit des Menschen, an den technischen Fortschritt und an die Vernunft freier Menschen glauben. Es ist nicht notwendig, Entscheidungen für kommende Generationen zu treffen. Entscheidend ist heute und auch künftig nicht die Weisheit einer Regierung, sondern die Freiheit des Individuums.
Abschließend gestatten Sie einige Bemerkungen über die Europäische Union. Einerseits bin ich als »Präsident der Tschechischen Republik« hierhergekommen. Andererseits hat die Tschechische Republik durch die Unterzeichnung des Vertrags von Lissabon ihren Status als unabhängiger Staat verloren; heute bin ich bloß Präsident eines konstituierenden Elements eines kürzlich geschaffenen europäischen Staatswesens, und das war nicht immer so.
Ursprünglich waren in den fünfziger Jahren die Grundgedanken der europäischen Integration: freundschaftliche Zusammenarbeit statt Kriegführen, Liberalisierung, generelle Öffnung, die Abschaffung verschiedener Hindernisse an den Grenzen für den freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen sowie von Menschen und Ideen auf dem europäischen Kontinent. Das war für die meisten Europäer ein positives Konzept und hätte die Chance haben sollen, von allen jenen weitergeführt und gefördert zu werden, die im Sinne der europäischen Wortbedeutung liberal gesinnt waren, das heißt, deren Weltanschauung weder etatistisch noch nationalistisch war.
Zu meinem großen Bedauern ist das heute nicht mehr der Fall. Die Situation hat sich in den achtziger Jahren zu ändern begonnen. Und die entscheidende Wende im Dezember 1991 erfolgte mit dem Vertrag von Maastricht. Zu diesem Zeitpunkt war die Integration zur Vereinigung geworden, die Liberalisierung zur Zentralisierung der Entscheidungsprozesse, zur Angleichung von Vorschriften und Gesetzen, zur Stärkung der europäischen Institutionen auf Kosten der Institutionen der Mitgliedstaaten, zu einer Post-Demokratie. Die Freiheit, die Demokratie und das demokratische Verantwortungsbewußtsein – nicht zu reden von der wirtschaftlichen Effizienz, vom Unternehmertum und der Wettbewerbsfähigkeit – sind geschwächt worden. Das Demokratiedefizit wird immer größer.
Der fast zehn Jahre alte europäische Streit über eine europäische Verfassung (derzeit als Vertrag von Lissabon bezeichnet), fand im November des vorigen Jahres sein Ende, als ich ihn unterzeichnete. Es war das der Streit zwischen jenen, die diesen, die Freiheit und den Wohlstand gefährdenden Prozess fortsetzen und jenen, die ihn abbrechen wollten. Und so empfinden wir – die wir den größten Teil unseres Lebens unter einem autoritären und unterdrückenden Regime gelebt haben – die Lage, und deshalb bemühen wir uns davor zu warnen.
Hervorhebungen von V. K.
Václav Klaus, Europäische Rundschau, No. 1/2010 (Vortrag im Mittel- und Osteuropa Forum in Wien am 19. Jänner 2010)
(Die Übursetzung aus Englisch)
- hlavní stránka
- životopis
- tisková sdělení
- fotogalerie
- Články a eseje
- Ekonomické texty
- Projevy a vystoupení
- Rozhovory
- Dokumenty
- Co Klaus neřekl
- Excerpta z četby
- Jinýma očima
- Komentáře IVK
- zajímavé odkazy
- English Pages
- Deutsche Seiten
- Pagine Italiane
- Pages Françaises
- Русский Сайт
- Polskie Strony
- kalendář
- knihy
- RSS
Copyright © 2010, Václav Klaus. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných na tomto serveru.