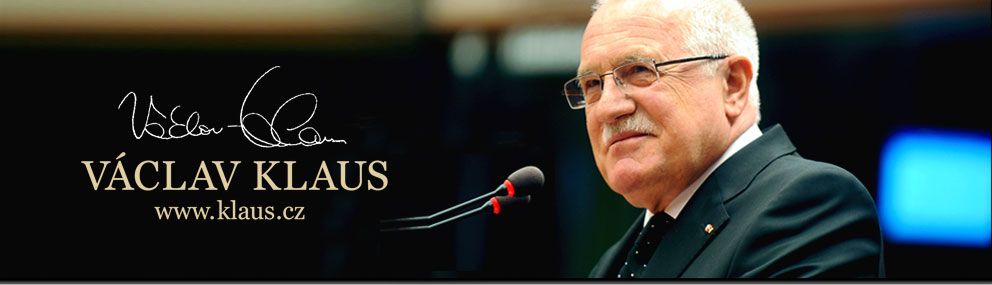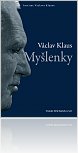Nejnovější
- Václav Klaus pro Lidové noviny o své nové knize „Dílčí reformy jsou málo, řešením je systémová změna“
- Páteční glosa IVK: Podceňovaná negativní stránka digitalizace
- Přání Václava Klause k 90. narozeninám Jana Klusáka
- Václav Klaus na CNN Prima News o své nové knize "Dílčí reformy jsou málo, řešením je systémová změna"
- Václav Klaus ve 50. díle pořadu XTV: Pane prezidente!
Nejčtenější
- Milan Knížák: Injekce pro Ameriku
- Václav Klaus představil svou studii k potřebě systémové změny české ekonomiky
- Václav Klaus k vítězství Petera Pellegriniho v prezidentských volbách na Slovensku
- Václav Klaus: Dílčí reformy jsou málo – řešením je systémová změna
- Jiří Weigl: Slovenské volby a česká politika
Hlavní strana » Deutsche Seiten » Wie könnten die mittel- und…
Wie könnten die mittel- und osteuropäischen Länder wirtschaftliche Konvergenz erreichen?
Deutsche Seiten, 1. 2. 2006
Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihre Einladung. Schon lange Zeit habe ich in Zürich nicht gesprochen, deshalb halte ich diese meine Rede als – für mich - gute Gelegenheit meine Position zu den heutigen europäischen Prozessen und Entwicklungen hier in der Schweiz wieder einmal vorstellen zu dürfen. Man kann auch sagen, dass ich weitere Argumente zu meinem Aufsatz, der im letzten August in der NZZ veröffentlicht wurde, ergänzen möchte.
Das konkretere, engere Thema meiner Rede ist ein Problem, das für unsere Länder wirklich relevant ist: das Problem der heutigen oder zukünftigen Konvergenz – im Bereich der Wirtschaftsleistung und deshalb auch des Lebensniveaus – der mittel- und osteuropäischen Länder. Dazu gehört auch die Frage, was der Termin „Konvergenz“ bedeutet, die Frage des Unterschiedes zwischen nominaler und realer Konvergenz, und die Frage des eventuellen Beitrags der formalen EU-Mitgliedschaft dieser Länder zur ihrer Konvergenz. Ich werde mich auch bemühen, diese Themen in einen breiteren Kontext zu stellen.
In den letzten Jahren konnten wir manche Äusserungen über die historische Bedeutung der Erweiterung der Europäischen Union um 10 neue, meistens ehemalige kommunistische Länder Mittel- und Osteuropas lesen und hören. Diese Äusserungen habe ich aber meistens ungenügend, unanalytisch, oberflächlich und im Prinzip leer und uninteressant gefunden. Diese Fragen brauchen mindestens – als Anfang – eine elementare Strukturierung der kurzfristigen und langfristigen Kosten und Erträgen (oder Effekten) der EU-Erweiterung. In the long run we are all dead, sagte Keynes vor 70 Jahren. Wir sollen aber nicht nur die sichtbare und direkte Effekte in Betracht nehmen, wir müssen besonders die unsichtbare und undirekte Kosten mit grosser Aufmerksamkeit studieren.
Ein Effekt ist klar. Im Moment des Beitritts – und es war ein Beitritt mit vielen Ausnahmen und Einschränkungen (die für die alten EU-Mitglieder Vorteile darstellen) – haben die neuen Mitgliedsländer wichtige politische Anerkennung erhalten. Das war die formale Bestätigung des von ihnen erreichten Niveaus der politischen, wirtschaftlichen und zivilisatorischen Reife (oder Maturität), und die Bestätigung ihres heutigen Entwicklungsstandes und ihrer Stabilität. Durch die EU-Mitgliedschaft werden sie wiederum - nach einem halben Jahrhundert Unnormalität, nach einem halben Jahrhundert des Lebens im Komunismus - zu den normalen europäischen Ländern gezählt. Solche Anerkennung hat ihnen die Mitgliedschaft in anderen Organisationen – wie im Europarat, im IWF oder OECD – nicht gegeben. Für diese Länder und persönlich für die Bürger dieser Länder war es sehr wichtig.
Ich muss leider sagen, dass dies auch der einzige Hauptgewinn, der sich aus ihrer Mitgliedschaft in der EU ergab, war. Sonst sehe ich keine anderen unmittelbaren (oder direkten) Effekte. Sehr oft wird in diesem Zusammenhang vom Effekt der Öffnung, vom Effekt der Liberalisierung der Bewegungen von Personen, Waren, Kapital und Ideen gesprochen. Das ist korrekt, das sind die positiven Effekte. Aber diese Effekte haben wir vor zwei Jahren nicht erlebt. Das Maß der Öffnung dieser Länder gegenüber den EU-Ländern und auch umgekehrt (der Öffnung der EU-Länder gegenüber den neuen Ländern) änderte sich am 1. Mai 2004 nicht. Die Effekte der gegenseitigen intensiven Beziehungen wuchsen schrittweise schon seit dem Fall der Berliner Mauer im November 1989 und waren schon lange vor dem 1. Mai 2004 „verkonsumiert“. Sie sind nicht mit der formalen EU-Mitgliedschaft gekommen. Der Residualeffekt der Mitgliedschaft war in dieser Hinsicht relativ klein und schwierig zum Quantifizieren.
Klein war (und ist) der direkte finanzielle Effekt, besonders für die mehr entwickelten Länder unter den neuen Mitgliedern, wie z. B. für die Tschechische Republik. Einen bedeutenden Effekt sehe ich auch nicht darin, dass die neuen Mitgliedsländer die Möglichkeit erhalten, die Entscheidungsprozesse innerhalb der EU zu beeinflussen. Diese Möglichkeit ist in der heutigen institutionellen Umgestaltung der EU nur formal.
Das Wichtigere, und nicht positive, ist etwas Anderes. Die neuen Mitgliedsländer nahmen – bereits in der Zeit vor ihrem Beitritt – die EU-Legislative, acquis communitaire, an, und damit das europäische Modell der sozialen Marktwirtschaft, den wenig produktiven europäischen Paternalismus und Korporativismus, die mit der niedrigen und sinkenden Konkurrenzfähigkeit der Firmen, mit der Rigidität der Wirtschaft, mit hoher Arbeitslosigkeit und mit dem langsamen Wirtschaftswachstum fest verbunden sind. Ich bin nicht der einzige, der überzeugt ist, dass diese EU-Legislative nicht die ordnungspolitische Rahmenbasis für die freie Marktwirtschaft ist. Meine feste Überzeugung ist, dass die neuen Mitgliedsländer dadurch nicht zu der wirklichen wirtschaftlichen Konvergenz geführt werden. Im Gegenteil. Es droht, dass diese, nur nominale, das heisst institutionale und legislative Konvergenz eine Bremse der realen Konvergenz, der Konvergenz von Wirtschaftsleistung und Lebensniveau, sein wird. Das ist für die mittel- und osteuropäischen Länder keine gute Perspektive. Ich bin nicht sicher, ob sie sich dessen bewusst sind.
Das ist nicht alles. Das zweite Problem, das wahrscheinlich noch wichtiger ist, ist mehr politisch als ökonomisch. Der heutige europäische Kommunitarismus und/oder Supranationalismus sind für mich – und für viele andere Europäer – mit dem gefährlichen demokratischen Defizit und mit der Postdemokratie verbunden. Ich gehöre zu denen, die diese Gefahr als seriöse Bedrohung für unsere Zukunft betrachten. Die bittere Erfahrung mit unserer kommunistischen Vergangenheit macht uns – in dieser Hinsicht – empfindlich, oder vielleicht sogar überempfindlich.
Ich gehöre auch zu denen, die ernsthaft bezweifeln, dass es möglich ist, die Freiheit und Demokratie ohne die Einhaltung der Institution des Staates und ohne direkte Bindung der Bürger an diejenigen zu bewahren, die über sie und für sie Tag für Tag Tausende wichtigen Entscheidungen machen. Wenn ich das sage, ist es meinerseits keine apriorische Verteidigung des Staates (oder einigen konkreten Staaten) gegen maximale Freiheit der Bürger, aber eine Verteidigung der Bürger gegen ungewählten Politiker, Bürokraten und lauten und engagierten (für sich selbst) NGO’s, die - zusammen, Hand in Hand – die internationale und supranationale Organisationen regieren.
Es ist evident, dass für etwas der Staat – in seiner normalen europäischen Dimension – zu gross ist. Das wissen die Schweizer sehr gut. Deswegen brauchen wir (und haben wir) Gemeinden und Regionen, oder Kantonen. Für etwas anderes ist der Staat zu klein, was der Grund für die Entstehung von verschiedenen staatsübergreifenden Institutionen ist. Das ist auch evident. Heute sind wir in Europa viele, die denken, dass auf der EU-Ebene unnötigerweise zu viel entschieden wird. Welche „public goods“ zu welcher Entscheidungsebene gehören, ist und bleibt ein ewiger Streit. Eine Sache ist aber klar: für die Demokratie ist der Staat genau entsprechend. Staatsübergreifende Strukturen sind für die Demokratie zu gross.
Das ist gut bekannt, jetzt droht aber etwas Neues. Die gegenwärtige grösste Gefahr – in diesem Zusammenhang – sind die Nachfolgerungen der EU-Erweiterung und die, damit verbundenen quasilogischen Argumente, dass die EU-Prozeduren und Entscheidungsmechanismen gerade jetzt pragmatisch und rational vereinfacht werden sollen. Das dürfen wir nicht akzeptieren. Die Vereinfachungen von Entscheidungsprozeduren und die demokratische Represäntierung bei den Entscheidungen sind nicht in direkter Proportionalität. Es gibt ein trade-off zwischen ihnen, es ist entweder – oder.
Die Erhöhung der Mitgliederanzahl von 15 auf 25 bedeutet eine Vergrösserung der EU als Institution. Damit kommt es zur Erhöhung der Transaktionskosten des EU-Funktionierens. Diese Kosten müssen wir entweder akzeptieren (und bezahlen oder tragen) oder eliminieren. Die EU-Politiker sind bereit (und motiviert) eine sehr gefährliche Methode zur Eliminierung dieser Transaktionskosten anzunehmen: eine weitere Stärkung des demokratischen Defizits, eine weitere Senkung des Ausmasses von demokratischen Prozeduren zu Gunsten der hierarchischen Prozeduren, eine weitere Erhöhung der Anzahl von Bereichen, in denen innerhalb der EU eine Mehrheitsabstimmung erfolgt. Zweifellos gehört dazu auch der Anstieg der Anonymität von Entscheidungen, wachsende Entfernung des Bürgers vom EU-Zentrum, weitere Entpersonifizierung der EU, usw.
Das dürfen die Europäer nicht akzeptieren. Ich bin überzeugt, dass die politische Seite des heutigen europäischen Problems so wichtig ist, dass sie der Grundbaustein und Hauptkriterium bei dem Weiteraufbau der europäischen Integration sein muss. Man kann Europa nicht mehr und mehr, weiter und weiter, tiefer und tiefer unifizieren (und zentralisieren) und nur dann, nachträglich, das Grundsätzliche – die Demokratie – suchen. Demokratie geht mit Kommunitarismus und Supranationalismus nicht zusammen. Das sollte der Ausgangspunkt unseres Denkens sein.
Nicht nur die Form der Integration ist das einzige heutige europäische Problem. Europa braucht auch ein anderes Model der Gesellschaftsordnung, ein anderes sozio-ökonomisches System. Wir brauchen Europa der wirtschaftlichen Freiheit, Europa der kleinen und sich nicht ausdehnenden Staaten, Europa ohne staatlichen Paternalismus, Europa ohne pseudomoralisierende politische Korrektheit, Europa ohne intellektuellen Snobismus und Elitismus, Europa ohne supranationale, gesamtkontinentale Ambitionen. Zusammengefasst, wir brauchen Europa ohne Ideologie des Europäismus.
Eine spontane Entwicklung in diese Richtung sehe ich heutzutage in Europa leider nicht. Die Volksabstimmungsergebnisse in Frankreich und in den Niederlanden sollten wir nicht falsch interpretieren. Sie haben keine genügende Basis für einen neuen Beginn geschaffen. Die Liberalisierungsphase des europäischen Integrationsprozesses ist schon – mindestens seit der Einleitung seiner Zentralisierungsära durch Jacques Delors – schon eine lange Zeit vergessene Vergangenheit und die Leute in diesen zwei Ländern haben keine Ambition die Liberalisierungsphase zu erwecken oder zurückzubringen.
Mit der Zentralisierungsära wurde das notwendige Gleichgewicht in Europa verloren. Die Erträge aus der Öffnung der Länder, aus der Liberalisierung der menschlichen Aktivitäten und aus der Abschaffung von Barrieren jeder Art waren und sind positiv, aber nicht alle, die damals existierten, sind bis zum heutigen Tag geblieben. In der zweiten Phase der EU-Integration wurden neue Barrieren konstruiert, unnötige Regulationen, Kontrollen und verschiedenste Beschränkungen von menschlichen Aktivitäten eingeführt, künstliche, pflichtige, niemanden befriedigende „europäische“ Standarden formuliert, die Homogenisierung der Menschen und ihrer Leben angefangen.
Die Hauptursache aller diesen Probleme sehe ich in der Ideologie des Europäismus, in dem, heutzutage in Europa herrschenden sozio-ökonomischen System, nicht in einzelnen Fehlern der Politik oder der Politikern. Diese Ideologie wurde leider nicht in Frage gestellt. Man sieht heute in Europa keine authentische „Reformneigung“. Verschiedene starke und laute rent-seeking Gruppen, die als NGO’s funktionieren, sind mit dem Status quo mehr als zufrieden und blockieren alle möglichen Veränderungen.
Das alles ist mit der Frage der Konvergenz verbunden. Wir wissen, dass die wirkliche, reale Konvergenz unter allen Umständen nur langsam verläuft. Bis heute wurde nie überzeugend nachgewiesen, dass die nominale Konvergenz zu einer realen Konvergenz beiträgt. Die nominale Vereinigung von Ländern wie Italien, Deutschland, Sowjetunion, Jugoslawien, aber auch Tschechoslowakei, führte – ohne weiteres, ohne Begleitung von massiven Finanztransfers – nie zu einer wirklichen Konvergenz der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Gerade das erwarten wir leider heute auch in Mittel- und Osteuropa.
Václav Klaus, Rede an der Swiss Finance Conference, Zürich, 1. Februar 2006
- hlavní stránka
- životopis
- tisková sdělení
- fotogalerie
- Články a eseje
- Ekonomické texty
- Projevy a vystoupení
- Rozhovory
- Dokumenty
- Co Klaus neřekl
- Excerpta z četby
- Jinýma očima
- Komentáře IVK
- zajímavé odkazy
- English Pages
- Deutsche Seiten
- Pagine Italiane
- Pages Françaises
- Русский Сайт
- Polskie Strony
- kalendář
- knihy
- RSS
Copyright © 2010, Václav Klaus. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných na tomto serveru.